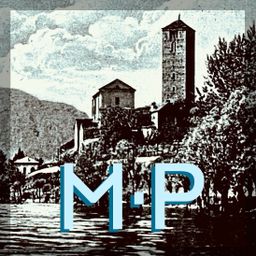Mit der konventionellen und oberflächlichen auffassung Heliogabals in dem nur drei jahre älteren ölgemälde hat Georges ALGABAL wenig zu tun. Während er mit minimalistischen kurzversen (in 3204) ein maximum an tiefe zu erzielen versteht schwelgt Alma-Tadema in opulenten farben und prunkt mit einer auswahl erlesener materialien wie seide und marmor. Der schaffensprozess selbst bildete den dekadenten luxus ab für den der imperator stand: einen ganzen winter lang liess sich der "marbellous painter" wöchentlich rosen von der Riviera in sein Londoner atelier schicken um jede ihrer petalen stets auf das genaueste abbilden zu können.
Die rosen als spenderinnen der tödlichen blütenblätter übernahm der Dichter während die spätantike Historia Augusta lediglich von blumen sprach. Ihr verfasser war nicht Aelius Lampridius wie M noch glaubte sondern gilt heute als anonym. Augenscheinlich mied er die nennung seines namens weil er sich der geringen seriosität seines mit skandalgeschichten gespickten werkes bewusst war. Für die kunst war es gleichwol noch anderthalb jahrtausende nach seinem erscheinen befruchtender als viele der nüchternen darstellungen ernsthafter geschichtsschreiber.
(Lawrence Alma-Tadema · The Roses of Heliogabalus · 1888)
3 ALGABAL
31 IM UNTERREICH 311-4
32 TAGE 3201-10
33 DIE ANDENKEN 331-8
Nach der mühsam beherrschten verzweiflung in den PILGERFAHRTEN zeichnet der ALGABAL die entwicklung eines von beginn an stets vornehmen jungen mannes nach der das vergebliche seiner grossen ambitionen mehr und mehr erkennt und sich durch die orientierung an der stoischen filosofie zu einer gelasseneren und ihrer verantwortung bewussten persönlichkeit entwickelt. Immer galt ja der entwicklung eines jugendlichen Georges augenmerk und sie wurde akribisch vermerkt (etwa im briefwechsel mit Morwitz).
Auch diese nun in drei zyklen geordneten zweiundzwanzig gedichte entstanden 1891 · in der zweiten jahreshälfte · und erschienen im folgejahr in wieder hundert exemplaren. Die öffentliche ausgabe kam zusammen mit den beiden ersten bänden 1898 (datiert:1899) heraus und war Albert Saint-Paul gewidmet der den jungen George in Paris betreut und bei Mallarmé eingeführt hatte. Diese ausgabe hatte auch wieder eine aufschrift in der Algabal den verstorbenen bayrischen König grüsst und sich dessen jüngerer bruder nennt. Gemeint ist also der Algabal des gedichtbands · nicht sein römisches vorbild Elagabal.
DEM GEDÄCHTNIS LUDWIGS DES ZWEITEN
ALS MEINE JUGEND MEIN LEBEN HOB IN SOLCH EIN LICHT
KAM SIE ERSTAUNEND DEINEM NAH UND LIEBTE DICH.
NUN RUFT EIN HEIL DIR ÜBERS GRAB HINAUS ALGABAL
DEIN JÜNGRER BRUDER O VERHÖHNTER DULDERKÖNIG
Mit dem von den antiken und neuzeitlichen historikern wol nicht zu unrecht in düsteren farben geschilderten römischen kaiser Elagabal und dem schliesslich für unzurechnungsfähig erklärten »verhöhnten dulderkönig« Ludwig II. greift George zwei gestalten auf um die damals gerade bei den französischen symbolisten ein kult entstanden war. Verlaine nannte den Wittelsbacher den einzigen und wahren könig seines jahrhunderts und George übernahm dieses urteil. So originell wie es uns heute erscheint war diese auswahl also keineswegs. Beide herrscher waren in ihrer zeit weitgehend isoliert und stellten sich gegen die gesellschaft in der sie lebten. Zumindest wollten sie nicht teil davon sein. Und das gefiel den jungen franzosen so gut wie George.
Ludwig II. sah mit grauen das aufgehen seines königreichs im von Bismarck geschaffenen preussisch-deutschen kaiserreich. Den gang der geschichte aufzuhalten war ihm unmöglich - sich anzupassen aber auch. So flüchtete er in die mittelalterliche aber selbst geschaffene neue welt seiner berühmten schlösser. Bezeichnend für sein wesen sind worte die von George selbst kommen könnten: »Ich bin einfach ganz anders gestimmt als die Mehrheit meiner Mitmenschen. Ich kann nicht teilnehmen an dem, was sie Vergnügen nennen, denn es widert mich an und zerstört mein Wesen.« (zit. nach Wk 2017, 62, Anm. 10). Nur in SIEDLERGANG 201 schien beim anblick der roten frauen eine anfälligkeit für diese »Vergnügen« den pilger gestreift zu haben. Der ALGABAL kann · sollte zwar als ausdruck der sympathiebezeugung Georges für Ludwig II. gelesen werden. Doch begleitet von beginn an eine erkennbare distanz die faszination bis im lezten gedicht des ersten zyklus (314) der lebenskonzeption beider herrscher eben doch eine art absage erteilt wird.
Auch diese absage hat bereits ein vorbild. 1884 war von Joris-Karl Huysmans der roman »À rebours« - »Gegen den Strich« oder »Wider die Natur« erschienen und wurde sofort das buch der Décadence und des Ästhetizismus schlechthin. Ein französischer adliger · Jean des Esseintes · kauft sich in Fontenay bei Paris ein abgelegenes Haus und richtet es sich so ein dass er bald keinen anlass mehr hat sich noch je in der verachteten gesellschaft blicken zu lassen. Er sammelt bücher · kunstwerke · edelsteine · exotische pflanzen und schläft am tage. Das nächtliche leben »wider die natur« ohne andere menschen (nur zwei bedienstete hat er in sein refugium mitgenommen von denen er aber möglichst nichts wahrnehmen will) ruiniert seine gesundheit derart dass er zulezt notgedrungen in die gesellschaft zurückkehrt. Ob ihm das guttut erfährt der leser nicht mehr.
»À rebours« hat bis in die heutige zeit gewirkt. Peter Doherty gab einem lied diesen namen (in Down in Albion) · Tocotronic verwendeten den namen der deutschen fassung. Der roman steht für die faszination eines ganz der kunst zugewandten naturfernen lebens ohne es naiv zu verherrlichen.
Bei George heisst der so geartete held nun eben Algabal. Der eigentliche name des römischen vorbilds war Varius Avitus Bassianus. Er wuchs unter der obhut seiner aus einer schwerreichen syrischen familie stammenden grossmutter Julia Maesa · der schwester der gattin von kaiser Septimius Severus der sich als adoptivsohn des angesehenen filosofenkaisers Mark Aurel bezeichnete · am hof des kaisers Caracalla auf · des sohns von Septimius Severus. Nach der ermordung Caracallas wurde dessen tante Julia Maesa wolweislich aus Rom verbannt und musste mit ihrem enkel nach Syrien zurückgehen. Dort unternahm sie genau das was die Caracalla-mörder verhindern wollten: Ihren reichtum nuzte sie um die karriere ihres enkels in die wege zu leiten der als dreizehnjähriger in der im syrischen bürgerkrieg oft genannten stadt Homs (damals Emesa) in Syrien wie sein urgrossvater (Julia Maesas vater Julius Bassanus) oberpriester des sonnengotts Elagabal wurde. Im folgejahr präsentierte Julia Maesa den angeblichen sohn des bei den soldaten immer noch beliebten Caracalla als Thronberechtigten und dessen mörder wurden in der schlacht von Antiochia durch die von Julia Maesa bezahlten · von dem eunuchen Gannys befehligten und angeblich durch die schönheit und herkunft des knaben begeisterten truppen der dritten legion besiegt. Dass dieser knabe bald darauf Gannys nur deshalb ermordete weil dieser ihn zu einem sittlicheren lebenswandel aufgefordert hatte wirft ein erstes schlaglicht auf seine so vielfach beklagte wesensart. Nun nannte sich der jugendliche kaiser der sich eigentlich mehr für seine religion und zunehmend weniger für die worte seiner grossmutter interessierte Marcus Aurelius Antoninus · ein grosser name den bereits sein »vater« sich zugelegt hatte um das hohe ansehen des berühmten filosofen auf dem römischen kaiserthron auf sich zu übertragen. Den schwarzen stein der in Emesa als Elah-Gabal verehrt wurde liess er nach Rom schaffen wo er in einem eigens errichteten grossen tempel auf dem Palatin zum mittelpunkt eines neuen und weiterhin von Elagabal als oberpriester zelebrierten staats-kults gemacht werden sollte. Die vier jahre seiner herrschaft (von 218 - 222) galten den römischen geschichtsschreibern daher als schreckenszeit des orientalischen einflusses und der dekadenz (des sittenverfalls und der schwäche). Erst nach der ermordung des kaum achtzehnjährigen wurde der bisher nur als beiname geführte name seines gottes (bisweilen auch in eigentlich falscher anspielung an den griechischen Helios »Heliogabal«) ganz auf ihn übertragen.
Elagabal war lange ein spielball seiner ehrgeizigen grossmutter Julia Maesa die sich während seiner regierungszeit Augusta (also kaiserin) nennen liess und den jüngling der bei den ihm fremden und wohl auch gleichgültigen senatoren alle unterstützung verspielt hatte zugunsten ihres zweiten und mit erst dreizehn jahren folgsameren enkels Alexianus Bassianus fallen liess um den bereits befürchteten putsch der praetorianer gegen die ganze sippe noch zu verhindern. Dessen mutter liess ihre schwester und deren sohn Elagabal durch soldaten ermorden. Nun ging alles nach bewährtem muster: Alexianus wurde als weiterer sohn Caracallas ausgegeben und nannte sich Alexander und wieder wie Caracalla und Elagabal Marcus Aurelius · dazu Severus wie sein vermeintlicher grossvater um noch einmal von den grossen namen zu profitieren. Es half nicht mehr viel und ein neuer Alexander wurde Severus Alexander trotz immerhin dreizehnjähriger herrschaft wie sein grosser namensvetter - den schwarzen stein des anstosses liess er nämlich klugerweise zurück nach Emesa schaffen - auch nicht. Die Perser konnte er nicht besiegen und starb mit seiner mutter während eines feldzugs gegen die Germanen durch meuternde soldaten. Das war nun doch das ende der syrischen dynastie. Seine grossmutter Julia Maesa - die in jenen jahren die eigentlichen fäden in der hand hielt - musste das nicht mehr erleben und starb kurz zuvor bemerkenswerter weise eines natürlichen todes.
Stefan George kannte die Elagabal-vita nicht nur über die symbolistenkreise sondern hatte wol auch schon 1891 bessere kenntnisse aus historischen quellen als M glauben machen möchte.
31 IM UNTERREICH
311 Ihr hallen prahlend in reichem gewande
sintern: sich verfestigen
bei armige riffe und gähnende drachen: bezieht sich auf korallenarme. »bei« lese ich als verkürztes »dabei«. M glaubt dass George einen von Goethe verwendeten akkusativ nach »bei« nachbilde.
Der erste zyklus gibt in vier gedichten einen eindruck von der künstlichen welt die Georges Algabal um sich errichtete - zu deren zahlreichen architektonischen und technischen raffinessen sich George durch den besuch von Schloss Linderhof im juli 1891 inspirieren liess (noch von dort berichtete er Saint-Paul davon). Der könig war fünf jahre zuvor gestorben und die schlossanlagen waren für das publikum bereits geöffnet. Wegen des enormen interesses daran erschienen bald ausführliche beschreibungen mit abbildungen so dass George auch ohne Neuschwanstein besucht zu haben sich gut auskannte. Christophe Fricker hat vor einiger zeit systematisch nachgewiesen welche in den gedichten genannten einzelheiten tatsächlich auf die bayrischen schlossanlagen zurückgehen (2011, 67ff.). George erledigt mit dem UNTERREICH die aufgabe die beiden exzentrischen herrscher in das in der aufschrift genannte »brüderliche» verhältnis zueinander zu bringen.
Um das künstliche und widernatürliche der privaten gegenwelt zu betonen werden die räume des bayernkönigs für Algabal unter den meeresgrund verlegt obwol es ja am strand prachtvolle hallen gibt die zu beginn angesprochen werden. Was »unter dem fuss euch ruht« sind die von Algabal ersonnenen häuser und landschaften. Ähnlich wie des Esseintes können ihn allenfalls »manchmal« aber nicht dauerhaft die ständig neuen sinnlichen reize befriedigen. Beispielsweise gibt es in der Venusgrotte des parks von Linderhof einen elektrisch betriebenen wasserfall · den von einem seil unter der wasseroberfläche gezogenen kahn und eine beleuchtung in wechselnden farben. George kommt dieses elektrische licht wie dauerhaft »währende kerzen« vor. Auch wellen und regenbogen konnten maschinell erzeugt werden worauf sich die lezte zeile bezieht.
Algabal und Ludwig sind aber nicht nur schönheitstrunkene künstler - sie haben auch freude an absoluter machtausübung die nicht einmal vor dem wetter halt macht. Dass in Algabals welt »ausser dem seinen kein wille schaltet« erinnert aber auch an den fürstensohn in FRÜHLINGSWENDE 052 der sich am wohlsten fühlt am »lieben orte wo er nur herr ist«. So ist die schlussfolgerung recht naheliegend dass auch Algabal als ein spiegelbild Georges aufgefasst werden kann.
Auch die beiden folgenden gedichte erschöpfen sich nicht darin langatmige beschreibungen von äusserlichem zu geben. Immer liegt die eigentliche pointe in der aussage über den genialischen erfinder dieser kunstwelt. Den grund seiner seele meint »unterwelt« ebenso wie die ganze architektur. Das gilt erst recht für die beiden folgenden gedichte.
312 Der saal des gelben gleisses und der sonne.
urnen: hier gefässe für duftende öle und harze - etwa das des amberbaums (liquidamber). Die etwas hoch gegriffene zahl erinnert an mittelalterliche litteratur deren zahlenangaben ebenfalls selten wörtlich zu nehmen sind.
Nach der vielfarbigen grottenwelt in 311 sind die anschliessenden drei räume in edler einfarbigkeit gehalten. Hier geht es um einen am thronsaal von Neuschwanstein orientierten raum dessen riesiger goldener leuchter unter einem gemalten sternenhimmel hängt der von einer gewaltigen goldenen sonne beherrscht wird.
Die sonne als herrscherin über die himmelskörper veranschaulicht nicht nur den stellenwert von Algabals gottheit sondern erinnert natürlich an jenen Ludwig dem sich der märchenkönig eng verbunden fühlte: den sonnenkönig dessen Versailler spiegelsaal hier mit dem bayrischen thronsaal eine verbindung eingeht. Hier aber sind die im siebzehnten jahrhundert noch ausserordentlich teuren spiegel sogar aus gold. Die monarchen-verehrung wird zwar durch den hinweis auf die herkunft des goldes aus krieg und gewalt scheinbar gebrochen aber - George ist nicht Brecht - ohne dass der leser zu einer moralischen wertung oder einem kritischen bewusstsein kommen muss. Eher ist gemeint dass eine von der gesellschaft sich abwendende kunst-welt auch nicht mehr den vorstellungen der ersten welt über gut und böse unterliegt. Georges hintersinniges fragezeichen ist dennoch zu erahnen.
Im vordergrund steht aber die absicht die besonderheit des herrschers rühmend herauszustellen: nur er vermag den aggressiven glanz des mit einer krone gleichgesezten goldenen leuchters auszuhalten der alle anderen blenden würde und über dem herrscher des römischen weltreichs zur »weltenkrone« wird. In der sprache gelingt George so die verschmelzung der beiden herrscher zu einem brüderpaar bei dem der eine vom anderen kaum noch zu unterscheiden ist. Für George hätte damals Hofmannsthal zu einem solchen bruder werden sollen. Der aber ahnte wol dass er zum blossen George-spiegelbild nicht geboren war. George mag der gedanke tröstlich gewesen sein dass auch für Algabal eine ebenbürtige entsprechung erst nach mehr als anderthalb jahrtausenden erschien.
313 Daneben war der raum der blassen helle
Nach den gelben geht es nun um weisse und transparente farbtöne · gleissende sonnenhitze wird durch angenehme kühle ersezt und die insgesamt aggressive grundstimmung durch feinsinnige sensibilität · am eindrucksvollsten veranschaulicht in der innigen beziehung zwischen den perlen und der menschlichen haut. Auch dieser saal verrät also viel über das wesen dessen der ihn ersann.
murra-stein: der schon in der antike bekannte fluorit oder flussspat.
gaben dumpfer stätte: die perlen werden daran erinnert dass sie ihrer künstlich scheinenden perfektion zum trotz doch nur natürlichen ursprungs sind: dem schmucklosen dunkel des muschel-inneren. Die anrede an die perlen passt aber dem sinn nach ebenso für gold und elfenbein und weckt erst recht die frage ob nicht die ganze kunst-welt viel mehr auf natürliche grundlagen angewiesen ist als sie glauben machen möchte.
Ein relikt aus der anderen welt ist auch das gewissen. Es lässt sich nicht so leicht abschütteln. Als Algabal eine murmel aus kindertagen findet hat er tränen in den augen. Stolz scheint es ihn doch nicht zu machen wenn er daran denkt wie er sich seitdem entwickelt hat. Wenigstens an diesem tag möchte er noch einmal die unschuld seiner kindheit empfinden und hält sich »rein« von allem woraus die historiker übereinstimmend das düstere bild Elagabals zusammentrugen. Wenn er aber einen ganzen saal in weissem glanz erschuf lässt sich ahnen dass die tränen mehr sind als nur ausdruck einer kurzfristigen sentimentalität und Algabal mehr ist als der trophäenhungrige löwenjager - der leidenschaftliche täter und tatmensch des gelben saals. Diese eher nachdenkliche seite Algabals ist der ersten gleichwertig: der zweite saal liegt - wie es schon im ersten wort heisst - »daneben«.
Zu recht bemerkt M dass die historisch nicht belegte bewegende erinnerung an die eigne kindheit viel mehr auf George denn auf Algabal verweist. Hingegen war der in 312 sich äussernde herrscherwille George auch nicht fremd. Die beiden säle verkörpern also auch zwei seiten seines wesens - anders gesagt: ihn.
314 Mein garten bedarf nicht luft und nicht wärme ·
zeug: es greift vielleicht zu kurz dies einfach als verkürzung von »erzeug« zu lesen. Es wäre ja angesichts der schwarzen bäume nicht schwierig auch eine schwarze blume zu erzeugen. Gemeint ist eine anspruchsvollere aufgabe deren lösung mit dem wunder einer (wol geistigen) zeugung zu vergleichen wäre.
schwarze blume: natürlich eine anspielung an die vergebliche suche der romantiker nach der blauen blume. Hier ist der anspruch sogar noch höher denn die schwarze blume soll nicht gefunden sondern sogar »gezeugt« werden. George gibt mit diesem bild seine distanz zu dem als ebenso vergeblich zu durchschauenden bemühen Algabals - und der ästhetizistischen lebensform zu erkennen.
Wetterwechsel duft und bunte farben eines gartens wurden in den ersten gedichten den innenräumen zugeschrieben. Nun bekommt der garten eine vergleichbare künstlichkeit indem er monochrom düster angelegt ist wie etwa der innenraum einer romanischen kapelle. Die erste zeile scheint einem lobpreis zu ähneln und die zweite verrät stolz auf das selbst geleistete denn dieses gedicht wird ja von Algabal gesprochen. Ähnlich sind die beiden folgezeilen gemeint - doch beginnt der leser hier die begeisterung über das geschaffene zu verweigern. Und wem die vielen schwarztöne in der zweiten strophe vielleicht noch gefallen wird sich doch auch bei der frage ertappen wie sinnlos dieser raum ohne zeit ist wenn niemand die schwer lastenden früchte erntet die nicht reiften und nicht vergehen werden. Verglichen mit sonnenaufgang und -untergang wirkt der immergleiche »graue schein« zum ende des UNTERREICHs bedrückend leblos. Nur Algabal sind alle zweifel fremd. Im »heiligtum« dieses gartens vermag er das alltagsbewusstsein völlig auszublenden und sich auf die vielleicht lezte und schwierigste aufgabe zu konzentrieren: die »zeugung« einer schwarzen blume. Aber die daumen drücken ihm dafür sicher längst nicht mehr alle leser. Unfreiwillig oder doch schon in stiller ahnung gibt Algabal den skeptikern sogar recht wenn er solche gedanken »gespinste« nennt.
32 TAGE
Die mit nur vier gedichten recht knapp gehaltene und durch die ersten hinweise auf Algabals persönlichkeit auch nicht ermüdenden beschreibungen räumlicher gegebenheiten werden nun abgelöst durch die faszinierende erzählung besonderer tage aus diesem herrscherleben. Zudem sind in abgrenzung zum unterreich natürliche »tage« gemeint mit morgen und abend. Das wird gleich zu beginn deutlich gemacht wenn die steigende sonne noch zu schwach ist gegen die nächtliche kühle in den schattigen höfen.
3201 Wenn um der zinnen kupferglühe hauben
kupferglühe: eine farb- nicht temperaturangabe in sprachlicher verkürzung.
basalt: dunkles gestein vulkanischen ursprungs · hier pflasterstein in einem grünlichen ton
Serer-seide: chinesische seide für die in Rom sehr viel geld ausgegeben wurde. Algabals seiden»kleid« bezieht sich auf Elagabals angeblich selbst entworfenes langes orientalisches und von den römern als unmännlich empfundenes gewand. Das anschliessende adverb »doch« wird dadurch verständlich: der verzicht auf armschmuck nimmt den weiblichen anhauch etwas zurück. Es gibt hinweise darauf dass Elagabal sich wie seine gottheit als ein androgynes wesen zwischen mann und frau darzustellen und dadurch seinem gott ähnlicher zu werden versuchte. Das befremdete die römer erst recht.
sardern: sardonyx · ein edelstein (karneol) aus Sardes in Kleinasien
Lyder: aus dem westlichen Kleinasien stammend. M weist darauf hin dass die Lyder als besonders schön und sanftmütig galten (was das tragische der tat Algabals noch einmal steigern würde).
Das erste gedicht der TAGE führt die für Algabal fundamentale (und von den Algabal als negativfigur missverstehenden interpreten dennoch nicht wahrgenommene) lebensbedingung vor augen: das aus der (in 3203 erklärten) bedrohtheit und verwundbarkeit des isolierten künstler-herrschers resultierende misstrauen mit der für sein überleben notwendigen gewaltbereitschaft.
Algabal wird nicht durch das leise und zunächst unbemerkte eintreten des Lyders - wol eines aus dem orient mitgebrachten lieblingssklaven oder jugendfreunds - erschreckt. Vielmehr ist das dadurch ungewollt ausgelöste ängstliche verhalten der tauben das für ihn beunruhigende. Seine bereitschaft sofort zum dolch zu greifen und die anschliessende höhnende gebärde Algabals deuten nicht auf willkür sondern auf seine ständige bedrohung durch attentäter. Auch einem ihm durch freundschaft und herkunft verbundenen konnte der weitgehend isolierte kaiser nicht trauen der zu jeder zeit die bestechungsgelder der grossmutter fürchten musste. Dieser sachverhalt konnte dem für einen moment unbedachten Lyder nicht fremd sein. Womöglich erkannte Algabal ihn gar nicht denn er hatte den kopf bereits geneigt · offenbar um nach orientalischem ritual kniefall und fusskuss zu vollziehen. Das leicht nachvollziehbare einverständnis des von seinem fehler tief betroffenen Lyders sich töten zu lassen belegt eine vorbildliche auffassung von aufopferndem dienst - einer grundidee im denken Georges. Übrigens hielt schon Friedrich Gundolf Algabal für den besitzer des dolchs (in: George 1920, 88f. Und in 7205 sind ALGABAL UND DER LYDER anders konzipiert was rückschlüsse auf 3201 ausschliesst).
Dass Algabal den weinpokal mit dem namen des getöteten gravieren lässt · damit den Lyder ehrt (und nach auffassung vieler interpreten seinen namen im kunstwerk verewigt obwol ein trinkgefäss nicht auf einer stufe mit einem Shakespeare-sonett steht: schon mancher becher wurde durch einen wurf in die fluten der ewigkeit entzogen) und sich selbst der ständigen erinnerung aussezt zeugt von seiner grösse · dem eingeständnis seines irrtums und den gefühlen die er für den Lyder eigentlich empfand. Von diesem punkt aus versteht man erst recht warum der Lyder so überzeugt in den tod ging: er kannte und verehrte Algabal. Nur germanisten die mehr Elagabal im kopf als ALGABAL vor augen hatten beklagten mit grosser gebärde brutalität und unmenschlichkeit (belege würden die ganze seite füllen). Dabei ist Elagabal immer nur die folie vor der sich Algabals grandiose gegensätzlichkeit entfaltet.
Und dass in der ganzen palastanlage ausgerechnet das von taubenkot übersäte columbarium Algabals »Traumbezirk« meinen soll den der auf »Exklusivität« bedachte kaiser »rein halten will« wie Klussmann in unfreiwillig komischer germanisten-weltfremdheit formuliert (1961, 89) · was der Werkkommentar ein halbes jahrhundert später nur unwesentlich zu Algabals »exklusivem Kunstbereich« (2017, 68) variiert der von dem auf zehenspitzen eintretenden Lyder »profaniert« worden sei · ist eine weitere von generation zu generation übernommene groteske ohne die man die erwünschte poetologische deutung eben nicht hinbekommt. Dann müsste doch zuerst die naheliegende frage beantwortet werden warum der Lyder wider besseres wissen ausgerechnet einen exklusivbereich betrat wo der sichere tod auf ihn wartete. Und war nicht vielmehr das unterreich der »exklusive Kunstbereich«? Hier war Algabal doch lange genug ungestört mit sich allein. Wozu nun über der erde ein weiterer sperrbezirk? Denn in 3201 befinden wir uns in den im ersten vers genannten »hallen« (311). Unten hätten keine tauben aufs dach fliegen können denn es gab ja nur »leblose schwärme« (314) und die oberseite des dachs wäre unerreichbar gewesen. Schliesslich: George hat alle sorgfalt darauf verwendet die tat aus dem erschrecken Algabals zu erklären - ganz unnötig wäre sie bestrafung für ein unbefugtes betreten des geheiligten raums gewesen.
Dass der mann aus kleinasien sich selbst erstach wie M angibt würde bedeuten dass Algabal das tragen einer waffe in seiner engsten umgebung duldete. Zanucchi glaubt ebenfalls an selbsttötung · findet sie aber »psychologisch nicht sonderlich plausibel« (Werkkommentar, 68). Das wäre sie durchaus. Man darf seinen Herrn - der so gefährdet und daher nervös ist - nicht unbedacht in todesangst versetzen. Die lösung ist aber einfach und geht aus dem text klar hervor wenn man nur die zeitformen beachtet. Der Lyder denkt: »Ich sterbe gern« weil er spürt dass Algabals dolch »schon« in seiner brust »stak« (obwol die strofe im präsens beginnt und endet). Bei einer selbsttötung würde er zuerst den gedanken fassen dass er den tod verdient hat und anschliessend käme erst der dolch ins spiel.
Zanucchi kann auch nicht recht gegeben werden wenn er wie zahlreiche vorgänger versucht Algabal hier einen zynischen ästhetizismus zu unterstellen. Der jugendliche kaiser glaubt soeben einen mordanschlag abgewehrt zu haben und »wich« sofort wohlweislich vom schauplatz des geschehens · unsicher ob nicht noch ein komplize lauert. Für das »ästhetische Farbenspiel des Blutes auf dem grünen Porphyr« kann er in diesem moment des zurückweichens gar kein auge haben. Dass er es sogar »goutiert« (bei Klussmann 1961, 89: »geniesst« und ebenso bei Durzak 1968, 228) entspringt allein der fantasie der interpreten die von ihrem vorgefertigten schema des super-ästhetizisten nicht lassen wollen der ja nicht nur alle moral über bord wirft sondern auch allen selbsterhaltungs-instinkt verliert wenn nur ein blutfleck hübsch aussieht. Dass solch ein träumer jemals römischer kaiser werden konnte ist wol nur für die germanistenschar vorstellbar und unterstellt George eine realitätsvergessenheit die seinem niemals weltfremden denken fern gelegen hätte. Tatsächlich wusste schon Goethe: »Unfühlend / Ist die natur« und sie ist auch hier pietätlos genug das blut auf den basalt rinnen zu lassen und damit im falschen moment jenes rotgrün zu erzeugen das der ähnlich herzlose sprecher im stil eines protokollanten notiert der seine neutralität betont · die anzeichen einer moralischen wertung oder emotionalen erschütterung beherrscht vermeidet und - von den bildern der medien noch nicht gesteuert - nicht weiss dass neben jeder noch so fremden leiche »Warum?«-schilder aufzustellen sind um betroffenheit zu zelebrieren.
3202 Gegen osten ragt der bau
dem grossen Zeus: gemeint ist natürlich gerade nicht Zeus sondern die syrische sonnengottheit deren namen ihr priester trägt und die nun die bisher Zeus oder römisch Jupiter vorbehaltene stellung als höchste gottheit übernimmt.
frönen: hier muss man »fronen« mitdenken. Dem Zeus zeit widmen · ihm dienen.
Knaben die ein opfer feit: die am kult beteiligten syrischen knaben sind kastriert. In den »sonnenschlaffen ländern« Arabiens (in welchem ausdruck sich ihre impotenz hübsch spiegelt) schütze sie das. Wovor? Dem sonst nur durch den tod abzuwendenden schicksal ein mann werden zu müssen (vergleiche 116 und natürlich 313).
Narden: die indische narde oder speik. Daraus gewonnenes öl wurde von männern zum einreiben in die haare benuzt. Die verwendung als räucherwerk beim Elagabal-kult ist ebenso belegt wie das streuen von lilien und narzissen auf dem weg des priesters - dazu präsentiert Zanucchi alle einzelheiten im Werkkommentar (2017, 69).
mirren: meint das in Arabien erzeugte harz der myrrhe woraus ebenfalls räucherwerk und salböl erzeugt wurden. George zielt hier auf das für römer fremdartige der schweren östlichen düfte.
quall: eine für George typische wortbildung. Das allerdings eigentlich alte substantiv bezeichnet alles was quillt.
Das gedicht widmet sich Algabals funktion als oberpriester des orientalischen kults bei einer prozession zum neuen tempel auf dem Palatin. Die in der lyrik so schwierige darstellung eines glücklichen menschen ist George nicht nur hier gelungen. Die behauptung dass es zu einer versöhnung von römischen ansprüchen an einen würdevollen gottesdienst und den fremd erscheinenden anblicken komme die als »tolle wunder« die römer aber doch eher schockieren verrät viel optimismus eines dem geschehen sehr gewogenen sprechers dessen perspektive sich von der Algabals kaum noch unterscheiden lässt und der - als sei er selbst der priester - nun die knaben und die »verführend« gekleideten tänzer auffordert dem kaum Älteren die ehrenden gesten entgegen zu bringen die ihn eigentlich zum gott machen. Erotik und vergottung eines noch sehr jungen mannes bilden die »tollen wunder« die den konservativen römern von Algabal zugemutet werden. Der nähert sich nun dem bild des »zwiegestaltigen« also in seinem geschlecht nicht festgelegten gottes den er als einziger »gast« besuchen darf weshalb die begleiter zurückbleiben. Das auf seine ekstatische begeisterung deutende »lallen« des betenden und segnenden priesters und das ineinander der strengen und der süssen düfte · dazu die vor dem grossen tempel hallenden »jungen stimmen« lassen einen rauschhaft sinnlichen eindruck zurück aus dem das gedicht nicht mehr herausführt und der erahnen lässt warum dieser kult dem Algabal so viel bedeutet. Ihn hast du hier in seinem grössten glück gesehen das er in Rom erfahren konnte und das schon im nächsten gedicht aufs äusserste bedroht ist.
3203 O mutter meiner mutter und Erlauchte
Erlauchte: Julia Maesa führte den titel »Augusta«
Der höhepunkt der TAGE mit der darstellung der inneren revolte gegen die autorität der grossmutter · wie 314 von Algabal selbst gesprochen und an Julia Maesa gerichtet.
Algabals eigene mutter gewinnt in der geschichtsschreibung kaum eigene konturen. Auch hier ist nur von der erziehung durch die grossmutter die rede. Aber Algabal ist zu stolz und aus gutem grund zu eigenwillig zur unterordnung geworden: sein geist gehöre ihr nicht und gegen ihren ungerechten vorwurf der tatenlosigkeit erinnert er an seine durchaus heroische rolle in der schlacht von Antiochia. In der tat berichtet der von George geschäzte Edward Gibbon dass Varius Avitus Bassianus »who in the rest of his life never acted like a man, in this important crisis of his fate approved himself a hero, mounted his horse, and, at the head of his rallied troops, charged sword in hand among the thickest enemies« (in: Decline and Fall of the Roman Empire, I, 6, 1776).
Diese tapferkeit bescherte ihm freilich was er im nachhinein betrachtet gar nicht wollen konnte: Emesa zu verlassen und in Rom die führung zu übernehmen. Deshalb hat er damals »die erde noch nicht begriffen« während er zum zeitpunkt des sprechens verstanden hat dass sein irdischer platz nicht in der politik - »blödes werk« nennt er sie - sondern im priestertum und in der kunst zu finden ist. Das radikale »Ich habe euren handels wahn erfasst« klingt schon wie eine absage an die ganze gesellschaft aus einem späteren zeitgedicht. Der mit dem amt des kaisers verbundene ruhm bedeutet ihm nichts und erst recht möchte er sich nicht dem zwang der notwendigkeiten unterwerfen die ein politiker anerkennen muss. Lieber möchte er sich wie im UNTERREICH gezeigt gestalterisch »frei« ausleben: innerhalb der »bedingten bahnen« der höheren gesetze und der vorsehung (womit er Georges vorstellung von der menschlichen willensfreiheit entspricht). Algabal ist hier völlig im recht denn untätig war er nie. Für seine viel zu einseitig wertende grossmutter der er geistig längst überlegen ist (wenn auch nicht im politischen ränkespiel) zählen aber alle taten ausserhalb von politik und krieg wenig. Dass sein cousin Alexianus den er hier bruder nennt was seine eigentlich liebevolle zuneigung ohne eine spur von feindseligkeit verdeutlicht nicht anders geartet ist sondern sich nur dem einfluss · dem »zwang« der Julia noch nicht entzogen hat ist Algabals erklärung für die entfremdung zwischen beiden. Damit macht er sie auch verantwortlich für die als selbstverteidigung völlig legitime gewalttat die er in der lezten strophe als möglichkeit vor augen führt - ohne die ausgeprägte vorstellungskraft die er mit dem jungen George gemein hat wäre es ja zu den bereits bekannten architektonischen entwürfen gar nicht gekommen. Doch ist dies alles andere als ein schwelgen in gewaltfantasien - es handelt sich um eine aus dem kalkül geborene warnung. Tatsächlich hatte Julia Maesa Elagabal dazu gezwungen den zwölfjährigen Alexianus zu adoptieren · ihn zum Caesar zu ernennen und damit als nachfolger zu designieren. Alexianus aber sollte nach den schlechten erfahrungen mit Elagabals orientalischem gehabe den römern nicht als Syrer sondern als einer der ihren präsentiert werden. Julia Maesa liess ihn anders als zuvor Elagabal ganz für diese aufgabe als kaiser erziehen und sich mit einer toga kleiden - für Algabal ein »sklavenhemd«.
Absurd ist Osterkamps idee in diesem gedicht werde der »moralische einspruch weiblicher instanzen - Großmutter und Mutter - gegen die inhumane Ordnung von Algabals Reich intransigent zurückgewiesen« (2010, 264). Erstens ist von einem handeln der mutter im ganzen zyklus keine rede. Zweitens ging und geht es ausgerechnet der skrupellosen Julia Maesa - der historischen wie auch der des gedichts - niemals um moral. Und drittens unterläuft Osterkamp eine fatale verwechslung der litterarischen mit der historischen figur: dass es in Algabals reich inhuman zugehe ist ja nun eben gerade nicht der fall. Aber Osterkamp ist einfach jedes noch so unsaubere mittel recht wenn es nur dazu geignet scheint Algabal als mittäter bei Georges grossem unternehmen zu überführen alles weibliche auszulöschen.
In der tat versuchte Elagabal als er die bedrohung erkannte mehrmals den knaben ermorden zu lassen. Auch diesbezüglich widerspricht das gedicht nicht den historischen grundlinien · schwächt aber konkretes zu einem bloss vorgestellten handeln ab. Beeindruckend ist wie sehr es Algabal gelingt von seiner friedfertigkeit zu überzeugen und dennoch der grossmutter - die er voller respekt und ohne jede feindseligkeit anspricht - eine nachdrückliche warnung vor augen zu führen. Die »purpurschleppe« - zeichen seiner stellung und von George wirkungsvoll an den schluss gestellt - wird auch zulezt noch in seinem besitz sein. Der leser weiss dass es bei Elagabal ganz anders kam. Das bedeutet nicht dass sich Algabal irrt. Er wird (in 3209) rechtzeitig vorkehrungen treffen nicht in gegnerische hände zu fallen: notfalls stirbt er von eigener hand. Aber im purpur.
3204 Becher am boden ·
broden: eigentlich brodem · hier ausdünstung oder duft
Traufender düfte: bezieht sich auf duftöle die aus einem behältnis träufeln
Manen: die blumen werden hier als grüsse oder »küsse« der geister der Toten aufgefasst
Das fest hat den lezten abschnitt erreicht wo die freude in zügellosigkeit und schliesslich in langeweile und bewusstlosigkeit übergegangen ist. Bemerkenswert ist hier die erstmalige verwendung des worts »kränze« als bestandteil festlicher kleidung. In der zweiten strophe geht der bericht des sprechers wieder unmerklich in die worte oder gedanken Algabals über. Der wünscht sich dass sein fest mit dem ende aller gäste enden möge. Wie Elagabal dieses ende bereits vorbereiten liess ist durch die römische geschichtsschreibung überliefert: in der hallendecke wurde eine klappe installiert aus der bei öffnung solche mengen von blumen herabfallen konnten dass einige gäste darunter erstickten. Algabal aber geht es hier nicht um die freude an technischem tötungs-schnickschnack oder um zynische unterhaltung oder ein neues feuerwerk der effekte. Er ist vielmehr noch immer ganz gottgleicher priester und wünscht sich den gästen ein schönes sterben auf dem höhepunkt eines festes zu verschaffen. Die blumen sollen die durch die ein«schläfernden« düfte halb Betäubten noch einmal »liebkosen · laben und segnen«. In dieser idee des schönen sterbens scheint sich Georges späteres konzept des schönen lebens erstmals anzukündigen.
In erster linie aber meint das gedicht den durch Algabal wenigstens scheinbar errungenen sieg des schönen über den tod auch wenn am ende die blumen verwelkt · doch die toten nicht wieder lebendig sein werden. Dass mit dem leben des hauptstädtischen partyvolks und der vergnügungssüchtigen höflinge in seinen augen nicht allzu viel verloren ist wird man wol unterstellen dürfen. Er selbst zählt sich nicht dazu · hält abstand und geniesst die perfektionierung seines fests lieber nüchtern. So wenig wie der eingangs zitierte Ludwig II. kann Algabal »teilnehmen an dem, was sie Vergnügen nennen, denn es widert mich an und zerstört mein Wesen«. Er fasst das fest eher als experiment auf - ähnlich wie er sich den schwarzen garten »selber erbaut« hat und nun von der schwarzen blume träumt (314). Beinahe wächst der verdacht dass Algabals vorgebliche fürsorglichkeit im dritten abschnitt eine neuerliche »höhnende gebärde« (3201) sein könnte. Dass George die lezten atemzüge der gäste mit hübschen reimspielen begleitet deutet nicht gerade auf eine distanzierung von der haltung seines schützlings hin. Leute diesen schlages lässt er auch in späteren gedichten gerne sterben (etwa in der TOTEN STADT 7113) und falls es richtig ist Algabal hier einen freilich nachvollziehbaren zynismus zu unterstellen so dürfte der die sympathie seines schöpfers gewiss nicht geschmälert haben. Die thematik des schönen todes wird in 335 noch einmal variiert und eindeutiger als woltat aufgefasst.
3205 Da auf dem seidenen lager
Erfolgreiche menschen unterstellen gern allen gegnern neid als motiv. Das wird hier spielerisch aufgegriffen und Algabal gibt derlei missgunst des sich verspätenden personifizierten schlummers die schuld daran nicht einschlafen zu können. Einen (alten) märchenerzähler oder gar eine griechische sängerin möchte er dennoch nicht an seinem »seidenen lager« sehen und bestellt sich lieber einen ägyptischen flötenspieler. Dessen kunst hat ihn auch früher schon in den schlaf versezt. Ein zwiespältiges lob für einen musiker · aber dieser flötenspieler vermochte den kaiser sogar in die sfären zu entrücken in denen er immer schon seinen eigentlichen platz sieht: in »äthergezelte« zum tisch der götter. Ob dies wirklich auf seine kunst oder darauf zurückzuführen ist dass er selbst es anders als das attische mädchen (dies die eigentliche botschaft des gedichts) vermag den kaiser in seine »bande« zu schlingen soll hier nicht entschieden werden. Grosse wertschätzung drückt sich jedenfalls auch in der direkten anrede aus - sogar im plural der zweiten person. Womöglich hat M recht wenn er glaubt Algabal spreche zu mehreren spielern.
Die metapher für das einschlafen weckt insgeheim doch den verdacht dass Algabal auch für sich selbst ein schönes sterben wünscht - dafür könnte ein einziger flötenspieler vor augen unter umständen durchaus genügen. Besser gesichert ist der eindruck dass nach dem spiel mit dem tod anderer in 3204 auch die vorstellung des eigenen sterbens für Algabal kein allzu strenges tabu bedeutet.
3206 So sprach ich nur in meinen schwersten tagen:
Bislang wirkte Algabal bei aller genialität eher hübsch und harmlos. Einen weichgespülten Elagabal wollte George aber auch nicht präsentieren. Die von den historikern so drastisch ausgemalte verbrecherische seite sollte nicht verschwiegen werden - ohne damit die prinzipielle zustimmung zu Algabal in frage zu stellen · ohne in widerspruch zu apfelblüte und friedenslamm zu geraten · und ohne dass die gleichsetzung mit Ludwig II. gar zu dessen nachteil geriet. Die bewältigung der anspruchsvollen aufgabe zu verfolgen ist eindrucksvoll. Am ende wird man feststellen: Georges Algabal käme nicht einmal in untersuchungshaft.
Es beginnt als sollte seine düstere seite sozusagen von vornherein in klammern gesezt werden: als liege alles schon weit zurück spricht der kaiser im präteritum. Nur in wenigen momenten habe er so gedacht - in seinen »schwersten tagen«. Was ihm zum vorwurf gereichen würde wird damit als folge einer zeitweiligen schwäche erklärt - etwa einer depressiven verstimmung angesichts eines überschweren schicksals. Und in ganzen zwei zeilen dargestellt - aber was die beinhalten ist nichts als eine willensbekundung deren umsetzung völlig offen bleibt. Schlimmstenfalls könnte man die grundzüge zweier dekrete darin vermuten. Aber auch unzählige andere herrscher haben zu allen zeiten jene mit dem tode bedroht die ihre religiösen vorgaben nicht ernst nahmen oder gar darüber lachten.
In der vierten der vier strophen sind alle dunklen wolken auch schon wieder ganz verschwunden. Da sind allerdings auch keine menschen mehr vorhanden. Allein mit sich selbst findet Algabal zu einer tiefen zufriedenheit und sanften klarheit: das friedenfrohe »neue lamm« (3203) ist wiederhergestellt. Der ausflug ins volk hat ihm seine einzigartigkeit bestätigt. Im spiegel hat der siebzehnjährige sich selbst gesehen - mit den zügen eines mädchens · das er wegen der nähe und ähnlichkeit »schwester« nennt. Dem ziel sich seinem androgynen gott immer mehr anzugleichen ist er damit viel näher gekommen als lediglich durch das anlegen von frauenkleidern.
Der willkürlich-sadistische gewaltherrscher dem sich Algabal (anders als Ili im BRAND DES TEMPELS) zu beginn anzunähern schien gerät beim leser durch die aufmerksamkeit für das merkwürdige spiegelbild fast in vergessenheit. Dazwischen liegen weitere gedankenfolgen. Zwei argumente dienen nur der relativierung der anfänglichen gewaltfantasien: entsprechende handlungen seien doch auch nichts anderes als das was »das leben« Algabal immer noch antue. Der gedanke ist angesichts seiner aufs höchste gefährdeten stellung · der einsamkeit in einer ihm fremden gesellschaft und nicht zulezt aufgrund der erinnerung an die gestohlene kindheit leicht nachvollziehbar. Zudem würde die mit brot (unter Elagabal kam es zu umfangreichen getreidespenden an sozial schwache) gesicherte und mit spielen hinreichend erfüllte existenz der römer selbst dann schwerer wiegen wenn sie unter ihm womöglich auch einmal gewalt leiden mussten (Georges konjunktiv »träf« muss beachtet werden).
Doch bietet Algabal weit mehr als nur raffinierte winkelzüge die einzig der entlastung dienen. Die grundsätzliche strategie läuft geradezu auf eine umwertung aller werte hinaus: sich dem volk dessen misshandlung Algabal sich zu beginn ausgedacht hat anzunähern · ja fast schon anzugleichen. George lässt ihn dazu an das stoizistische denken des kaisers anknüpfen dessen namen Elagabal für sich gewählt hat: Mark Aurel.
Der erste dieser gedanken bildet noch den schluss der eingangsstrophe. Sein groll gegen das volk laufe eigentlich auf ein handeln gegen sich selbst hinaus. Damit nimmt Algabal den grundgedanken der stoa auf dass alle handelnden gleichermassen teil des kosmos sind und somit irren wenn sie glauben von ihrem tun selbst nicht betroffen zu sein. So konnte Mark Aurel sein kaiserliches verantwortungsethos an die stelle des willkürlichen cäsarenwahns setzen. Schon vor ende der ersten strophe ist nun für den zu seinem schüler gemachten Algabal alles verwerfliche - das ohnehin nur ein gedachtes oder allenfalls gesprochenes war - gedanklich wie moralisch bewältigt und nicht mehr attraktiv.
Er selbst sei »als einer« nicht anders als die masse »als viele«. Fricker sieht in der fünften zeile die ähnlichkeit mit dem übrigens sogar an Schloss Linderhof angebrachten motto des sonnenkönigs: nec pluribus impar (2011, 72) dessen bedeutung und übersetzung aber umstritten ist. War die devise ursprünglich wol als ausdruck eines überlegenheitsgefühls gedacht so wird sie hier ins gegenteil verkehrt und macht den vermeintlichen täter erneut zum mit-opfer. Vor allem betont die formulierung aber den von stoikern wie Mark Aurel her bekannten gedanken einer grundsätzlichen gleichwertigkeit aller menschen. Dass Algabal allein so viel wert sei wie das ganze volk (und der einzelne im volk demnach so viel wie nichts) kann im zusammenhang gerade nicht gemeint sein.
Überliefert ist dass Elagabal es liebte sich unerkannt unter das volk zu mischen. Auch diese notiz der historiker nimmt George auf - er aber untermauert damit das neue bild von einem herrscher dem die einfachen leute durchaus etwas bedeuteten. Davon profitiert natürlich zugleich das des bayernkönigs der zu seiner zeit in sachen bürgernähe nicht gerade als führend galt. Auch bei dem angesehenen filosofenkaiser war das aber nicht gleichbedeutend mit grosser wertschätzung der lebensformen der masse: die formulierung von ihrem »leeren lärm« findet sich ganz ähnlich in seinen »Selbstbetrachtungen«. Hass auf einfache leute aber verbietet sich der stoiker wie alle erschütternden gefühle. Auch darin folgt Algabal den vorgaben des grossen lehrers. »Ich fürchte« klingt wie eine schulterzuckende absage an das klischee der historiker: Algabal fürchtet mit leise ironischer wendung dass er deren vorgaben bezüglich Elagabals menschenverachtung nicht erfüllen kann. Im gegenteil: dass diese menschen anderer · »eigner artung« auch manche »härte« zu meistern oder zu ertragen haben (und dadurch respekt verdienen) vermag Algabal jezt zu »ermessen« wo ihm seine ausflüge eine bessere kenntnis ermöglichten. Für George ist vielfach belegt ist dass er es liebte die handwerker zu beobachten · sich lange mit der zimmerwirtin zu unterhalten oder auch einmal in der gaststube mit den huren zu scherzen.
So wird auch der zusammenhang der vierten strophe erklärbar in der Algabal nun die aus 3203 bekannte »milde« und apfelblüten-zartheit zurückgewinnt. Auch die historische vorgabe seiner androgynität wird hier neu genuzt: Sie hat im grunde nicht mehr viel zu tun mit religiösen vorstellungen oder autarkie-fantasien Elagabals. Algabal sieht an seinen besten tagen zu denen das gedicht ja nun - beginnend mit den »schwersten« - geführt hat »beinah« wie ein mädchen aus weil er den mädchen ähnelt die George sich eben auch vorstellen konnte: der erträumten wie in 210 · der sehnenden wie in 208 oder Pamfilia die in 924 für den frieden kämpft. Das ist die äusserste leugnung jeglicher züge von gewalttätigkeit. Daran würde auch nichts ändern wenn man die beiden lezten zeilen lediglich als weiteren ausdruck des mit-sich-im-reinen-seins auffasste: wenn er in den spiegel schaut sieht er kein ungeheuer sondern nur sich selbst in geschwisterlicher vertrautheit (ähnlich in 5402).
So ist gerade 3206 als eine geniale umdeutung der Elagabal-figur zu verstehen die beweist dass der Dichter tatsächlich vermag was in 921 der Gehenkte (mit dem sich George weitgehend identifiziert haben dürfte) von sich behauptet: den starren balken zum rad biegen zu können »eh ihrs euch versahet«.
3207 Graue rosse muss ich schirren
Hier erfährt man mehr über die »schwersten tage« und während das vorige gedicht eine so überraschende wendung nahm bleibt die anfangs erwähnte graue farbe nun bis zulezt ohne aufhellung. Der angst-traum der ersten strophe beginnt mit dem gefühl des getriebenseins und der fremdbestimmung und endet mit einer todesahnung. Die zweite strophe ist eine absage an alle kriegsbegeisterung und helden-glorifizierung. Es folgt ein passendes landschaftsgemälde. Die roten bäche lassen auf einen zusammenhang mit dem schlachtfeld der zweiten strophe schliessen. Erst zulezt erscheinen menschen: frauen die sich weinend über verlezte beugen und nur von hinten gesehen werden so dass ihre gesichter im dunkeln bleiben. Die in wind und wetter strähnigen haare als pars pro toto entstammen der wahrnehmung · nicht der abstraktion. Die kunstvolle pointe bildet das doppelsinnige partizip »aufgelöst«.
Dass die abschliessende frage an der echtheit der trauer zweifelt ist zunächst vielleicht etwas verstörend. Doch wird damit jeglicher sentimentalität vorgebeugt und die gefühlte ausweglosigkeit der depression unterstrichen. 3207 drückt wie kaum ein anderes der gedichte die verzweiflung aus die keinem billigen trost · keiner abgedroschenen formel - keinem »Die liebe höret nimmer auf« mehr zugänglich ist. Aufgrund der geradezu pazifistischen haltung des hier erneut sprechenden kaisers ist das gedicht aber auch als weiterführung des neuen Algabal-bilds aufzufassen.
3208 Agathon knieend vor meinem pfühle ·
Der schwarze garten der keinen frühling erlebte war ein raum ohne zeit und damit ein allerdings zu teuer erkaufter und dennoch nur scheinbarer sieg über die vergänglichkeit gewesen. Ebenso wird Algabals rosenfest am besten als versuch zu begreifen sein die wiederkehr des alltags zu verhindern. Das ergebnis dieser experimente konnte nicht überzeugen. Auch Algabals tränen bei der erinnerung an die kindheit sind als ein wenngleich ohnmächtiger protest gegen das fortschreiten der zeit aufzufassen. Einem Vertrauten gegenüber - er ist eine fiktive gestalt - der mit diesem fortschreiten noch hadert zeigt Algabal dass er sich nun in das unvermeidliche zu fügen vermag.
Dieser Agathon - vielleicht ein familienmitglied und jedenfalls von edelster herkunft - kniet vor dem mit einem kissen (dem pfühle) ausgestatteten lager Algabals der den grund für seine tränen errät die er ihm fürsorglich trocknet. Algabal rät ihm sich nicht gegen den himmel zu empören der den kampf zwischen der strahlenden jugendlichkeit · ausgedrückt in den »über-leuchtenden adern« als pars pro toto · und den kräften des alterns und verlusts wie ein spiel geniesse das der nun schon bemerkenswert fromme Algabal »hehr« nennt weil es von diesen höchsten lebensmächten eben so gewollt ist. Es möge dem Agathon ein trost sein als einziger das altern auch des - für alle anderen fast gottgleichen - kaisers wahrnehmen zu können: ein »kranken« bis »zur urne gar« also sogar ein sterben (während Agathon nur seine schönheit verliert). Sie beide die das schicksal für die herrschaft bestimmte (weshalb sich hinter Agathon auch der historische Alexianus verbergen könnte) hätten nicht das recht zu einer solch irdischen klage - anders gesagt: sie haben die pflicht vergänglichkeit mit stolz hinzunehmen. Von diesem stolz ist Agathon allerdings nicht weit entfernt. Denn er hat ja gar nicht geklagt. Anders als im vorangegangenen gedicht sind nicht einmal »reiche tränen« geflossen - nur zu einem »feuchten schleier« haben sie gereicht. Ob sie »wahre tränen« waren muss diesmal nicht gefragt werden. Um sich selbst vergossene tränen sind immer wahr - um andere vergossene meistens nicht. Ein wenig Schopenhauer blizt manchmal auch bei George auf.
Georges bild von Algabal ist nicht statisch sondern zeigt dass dieser sich wie alle begabten jugendlichen entwickelt und übersteigerte positionen die manchmal gerade den besten zu eigen sind mit zunehmender reife aufgibt. Besonders aber ist dass Algabal die nähe seines todes schon bewusst zu sein scheint.
3209 Lärmen hör ich im schläfrigen frieden:
Iden: In Shaespeares tragödie ignoriert Cäsar die warnungen des hellsehers vor den Iden des märz (der zeit des vollmonds). Seitdem für: bevorstehendes unheil. Auch schlangendeuter konnten in Rom orakel sprechen.
sich vermessen: sich etwas unangemessenes zutrauen · eine frechheit begehen.
Das gedicht bezieht sich auf Algabals überlegung den sich ankündigenden versuchen ihn zu stürzen damit zu begegnen dass er vorher aus dem leben scheidet. Entsprechende pläne und konkrete vorkehrungen sind für Elagabal überliefert. Der von M zitierte Lampridius berichtet etwa von einem goldenen turm aus dem sich der kaiser stürzen wollte · und von stricken die natürlich purpurfarben waren. Der mit gift gefüllte ring muss älter sein und wird in 335 noch eine rolle spielen. Indem Stefan George dies aufgreift zeigt er einerseits den vornehmen stolz Algabals sein ende nicht von soldaten-»horden« bestimmen zu lassen. Unter welchen bedingungen die selbsttötung gerechtfertigt sei war ja ein thema schon der älteren stoa - auch bei Mark Aurel - und sie wären hier hinreichend erfüllt.
Zum anderen würde Algabal blutvergiessen nur zum erhalt seiner macht vermeiden. Auch insofern handelt er ganz im sinne der stoischen verantwortungsethik. Es waren eben keine hohlen worte als er sich selbst als friedenfrohes lamm bezeichnete (vergleiche 3203) .
3210 Schall von oben!
Das gedicht unterstellt dass Algabal auch musikanten und sänger aus Syrien mitgebracht hatte · offenbar auch zur begleitung von kulthandlungen. Ihre musik scheint eine starke wirkung auf Algabal gehabt zu haben. Jezt aber könnte sie ihn dazu verführen doch nicht vorzeitig aus dem leben zu scheiden. Deshalb fragt er sich ob er die Syrer nicht besser fortschicken sollte.
Hier deutet sich schon Georges Platon folgende tendenz an musik abzuwerten weil sie zu unangebrachter weichheit verleitet. Sich von ihrem einfluss zu befreien galt als fortschritt in der charakterlichen entwicklung. Auch die stoa schäzte es nicht wenn von der vernunft geleitete entscheidungen durch stimmungen in frage gestellt werden.
33 DIE ANDENKEN
Gemeint sind erinnerungen an die zeit der kindheit und jugend in der »heimat« Syrien.
331 Grosse tage wo im geist ich nur der herr der welten hiess ·
Mit der erinnerung an kindliche herrschafts-fantasien und der suche nach ruhe im hain erscheint der gedankenschwere Algabal wie ein zweiter Etienne George. Die rede von den götterkindern bezieht sich wol auf die auch in 322 genannten syrischen tänzer und knaben.
Algabal stellt sich vor dass der erinnerte als lebendiger gefährte und nicht nur als schatten an seiner seite wäre · nur eine gewisse blässe würde auf die mühe des wechsels aus der vergangenheit in die gegenwart deuten. Das »schwere wechseljahr« könnte aber auch auf das alter des Herbeigewünschten deuten: er ist in seinem vierzehnten jahr und wechselt damit in das dritte lebensjahrsiebent. George hatte seine sicht auf diese altersstufe ja in 052 dargestellt.
»Eine spaltung aus einsamkeit« nennt M Algabals vorstellung. Sie ist für den jungen George ganz fundamental und liegt wol all seinen suchen nach begleitern insgeheim zugrunde. Sie erklärt auch warum diese suchen nicht von erfolg gekrönt waren. Eine glückliche ausnahme darzustellen war nur dem jugendlichen George in seinem ersten erhaltenen gedicht möglich: PRINZ INDRA S31.
332 Fern ist mir das blumenalter
zähre: träne
garbe: die schafgarbe
Algabal stellt sich vor ein »sommerfalter« gewesen zu sein von dem nicht bekannt ist ob er den winter mit seinem rauhreif überlebt hat. Nach 331 ist es leicht zu verstehen dass die jahre in Syrien als sommer verstanden werden. Dessen glückliche tage werden in der zweiten und dritten strophe noch einmal lebendig. Aber auch damals schon waren die tage von einer vergeblichen suche erfüllt die nur im nächtlichen traum nicht umsonst schien der ihn mit der hoffnung auf eine tulpe im frühling »heilte«. Ob es sich dabei um täuschung handelte bleibt unklar weil man eben nicht weiss ob er beim längerwerden der tage den sang der vögel noch einmal hören wird. Das gedicht wirkt wie eine zusammenfassung der PILGERFAHRTEN.
333 Jahre und vermeinte schulden . .
schulden: hier der plural von moralischer schuld
Hulden: M erklärt sie als die griechischen chariten die den drei in der bildenden kunst häufig dargestellten römischen grazien entsprechen und erzählt liebenswert schwatzhaft dass George die Geliebten seiner jüngeren freunde gern als »Huldinnen« verspottete. Dass die Hulden Algabal aufgrund seiner anmutigen schönheit für dieses herausragende schicksal erwählten steht für ein mythisches denken völlig im einklang damit dass Elagabal doch von den soldaten auf den schild gehoben wurde. Die legionäre vollstreckten lediglich die entscheidung der Hulden. Um propaganda und selbstüberschätzung handelt es sich gerade nicht: wie Algabal das heil der völker schon in Syrien vermehrte indem er ihr daseinsgefühl »hob« (was der tempel in 924 eben nicht mehr vermochte so dass er zu recht verbrannt wurde) und wie Algabal das bedürfnis des volkes zu lieben erfüllte wird ja gerade in den anschliessenden versen atemberaubend deutlich gezeigt. »Heil der völker« ist hier griechisch gedacht: es geht nicht um heizkostenzuschüsse. Im grunde ist das ganze gedicht auch ein grosses plädoyer für das monarchische prinzip - aber in einer speziellen Georgeschen · erbarmungslosen prägung.
schöne: von George gern verwendeter ersatz für »schönheit«
hermen: Der begriff meint hier nicht die (aus dem Athener hermenfrevel bekannten) stelen mit kopfporträt sondern marmorstatuen die den ganzen menschlichen körper in seiner schönheit zeigen.
jaspis: in der antike besonders geschäzter edelstein der nicht nur in grüner farbe vorkommt
Wer hier so liebevoll zu Algabal spricht? Wahrscheinlich spricht er sich selbst an · wahrscheinlich ist es der Dichter. Diese gewollte unsicherheit zeigt wie ununterscheidbar beide eigentlich sind. Deutlicher wird der zeitpunkt: inzwischen sind »jahre« vergangen in denen Algabal (nach Antiochia) tatsächlich oder nur vermeintlich auch schuld auf sich geladen hat. Sie hat sich wie »hiebe« eingeprägt und seine schönheit schon gefährdet. Zweifellos ist dem sprecher eine moralische kategorie wie »schuld« längst nicht so wichtig wie die ästhetische der »schönheit«. Er fordert Algabal auf die unschön machenden spuren von bedrückung und selbstzweifeln von sich wegzuwischen. Das bewahren der schönheit ist schon nicht mehr selbstzweck: Das Algabal von den Hulden aufgegebene programm »den völkern« (gemeint sind alle im römischen weltreich) »heil und liebe« zu ermöglichen ist ohne sie gar nicht zu erfüllen. Das zu beweisen ist aufgabe dieser verse.
Bevor was seinen »grössten ruhm« ausmacht ganz verblasst ist soll er deshalb seinen körper im »weissen bade« pflegen - noch muss seine schönheit ja den vergleich mit den von der bildhauerkunst in weissem marmor Verewigten nicht scheuen. Die aber sind - so soll sich der leser denken - mit dem fortschreiten der zeit freilich doch der sichere sieger. Aufgegeben ist der gedanke von der überlegenheit der kunst ja nicht. Unbarmherzig zeichnet sich sobald er den auftrag der Hulden nicht mehr erfüllen kann noch ganz in der ferne auch Algabals ende ab.
Deshalb macht es mehr freude an die rauschhafte vergangenheit in Emesa zu denken als seine noch ungefährdet erscheinende schönheit die soldaten dazu brachte ihren jungen führer wie einen gott aufzufassen dem jeder nahe kommen wollte und dessen auftreten - wie die vierte strophe darstellt - eine massenhysterie auslösen konnte: seine blosse anwesenheit brachte die frauen zum stöhnen. (Ob Ludwig II. sich wirklich gefreut hätte dass er angeblich immer mitgemeint war?)
Bei George kann volk in solchen augenblicken der verehrung selbst schön werden (vergleiche 7108 und T062) und doch zieht es in seinen ganzen bedürftigkeiten den hohn dessen auf sich der ihrer nicht bedarf.
Wie schnell gerade in seiner zeit soldaten ihre meinung änderten · am liebsten dem meistbezahlenden dienten und häufig die seite wechselten wird Algabal damals auch bald klargeworden sein während er selbst in dem bewusstsein erzogen wurde einerseits als sohn eines kaisers und andererseits aufgrund seiner völligen identifikation mit der gottheit die höchsten ansprüche haben zu dürfen. Hinzu kommt das wissen um seine ausstrahlung · seine begabungen und ungewöhnliche künstlerische vorstellungskraft. Auch insofern ist seine verachtung der ihn begehrenden massen leicht verständlich die der sprecher hier als »gehöhnte« bezeichnet. Von George selbst berichteten ehemalige mitschüler allerdings dass sie schon in der schulzeit seine geringschätzung spürten. Bei Algabal schwächt sich diese haltung wie 3206 zeigte ab als er in Rom das leben der einfachen leute näher kennenlernt. Sadismus gar vermögen ohnehin nur germanisten in diesem gedicht zu entdecken (etwa Eschenbach 2011, 104): dass »die gehöhnten« ihn nur um so grenzenloser verehren bereitet Algabal nicht lust sondern ist zeichen seiner ausserordentlichkeit.
334 Am markte sah ich erst die würdevolle
Im schauspiel: nicht im circus sondern in einem amphitheater - wol im Colosseum - fanden die gladiatorenkämpfe statt. Der siegreiche gladiator durfte den todesstoss erst setzen wenn ihn eine vestalin durch senken des daumens dazu aufforderte. Umgekehrt konnte sie also begnadigen.
balsam: wolriechende harze und öle des balsambaums. Auch als räucherwerk bei kultischen feiern
die todberufenen den cäsar ehrten: zur zeit Georges (und selbst noch bei Asterix) glaubte man die gladiatoren hätten den kaiser vor dem kampf mit dem ruf »morituri te salutant« - »die dem tode geweihten grüssen dich« geehrt. Solche redewendungen und »geflügelten worte« fanden sich schon im neunzehnten jahrhundert im »Büchmann« · einer von dem gleichnamigen Berliner lehrer zusammengestellten zitatensammlung die sehr verbreitet war um etwa reden und ansprachen mit dem bildungsbürgerlichen hintergrund zu schmücken. George konnte darauf vertrauen dass ein leser die textstelle auch ohne studium der geschichte verstand: den Büchmann hatte und kannte jeder. Für die Arbeiterbewegung gab es einen eigenen Büchmann. Ein vergleichbares allen angehörigen einer kulturgemeinschaft gemeinsames wissen (das natürlich auch damals schon als halbwissen verspottet wurde) gibt es heute nicht mehr. Das ist der preis für freiheit und gleichberechtigung. Im George-Kreis war es noch einfach eine gemeinsame bildungs-grundlage durchzusetzen. Von der »Bibliothek eines jungen Menschen« · dem umfangreichen kanon - der liste mit den werken der weltliteratur deren kenntnis in drei dringlichkeitsstufen (unentbehrlich · nötig · nützlich) erwartet wurde - hat sich eine von Ernst Glöckner angefertigte abschrift erhalten (abgedruckt in: Groppe 1997, 482 - 97).
Elagabals grösster und für sein ansehen folgenreichster skandal drehte sich um seine zweite heirat. Von seiner ihm durch Julia Maesa wol eher aufgezwungenen ersten frau aus vornehmer römischer familie hatte er sich bald wegen eines muttermals oder eines sonstigen körperlichen makels getrennt den er als unvereinbar mit seinem priestertum ansah. Die zweite - eine priesterin der Vesta - beeindruckte Algabal auf dem Forum Romanum in ihrer schlichten wollweissen kleidung durch eine schöne und würdige haltung und bei gladiatorenkämpfe durch ihre strenge: sie neigte nicht dazu verlierer zu begnadigen. Und sie hob sich in ihrer gelassenheit ganz wie er selbst deutlich von der erregten menge ab. Tatsächlich berief sich Elagabal in einer rechtfertigung vor dem senat auf liebe was ihm die historiker aber nicht abnahmen. Das wichtigste wird im zweiten vers der dritten strophe nur angedeutet: dass die völlig regelwidrige hochzeit mit der zur keuschheit verpflichteten vestalin nur durch den missbrauch seiner macht möglich war. Eigentlich hätte ihm die todesstrafe und der vestalin das eingemauertwerden bei lebendigem leib gebührt. Man muss bedenken dass Elagabal als kaiser auch pontifex maximus · der oberste hüter der römischen religion und zugleich der aufseher über die von allen hoch verehrten vestalinnen war - oder jedenfalls sein sollte.
Er habe als priester eine priesterin heiraten wollen um mit ihr gottgleiche kinder zu erzeugen erklärte Elagabal dem empörten senat. Die begründung gilt auch heute noch als ernst zu nehmend. Bestenfalls mochte er sogar eine art verschmelzung beider religionen durch die symbolische heirat ihrer gottheiten angedeutet haben. Doch möchte man mit gleichem recht vermuten dass es Elagabal mit dem ungeheuerlichen frevel darauf ankam den römern die unterlegenheit ihrer alten götter zu demonstrieren. Christliche herrscher verfuhren wenig später vergleichbar rücksichtslos gegen das politisch bereits besiegte heidentum.
Die welt des römischen glaubens war zu Elagabals zeit aber fast noch in blüte. Sein politisch unbedachtes verhalten war mit Julia Maesa nicht abgesprochen und sie sezte nun die trennung der beiden durch. Im gedicht wird die priesterin »zurück zu ihrem herde« geschickt wo sie das heilige feuer zu hüten hat. Der Vesta-tempel war das römische nationalheiligtum schlechthin und das erlöschen des feuers bedeutete ein staatliches unglück. Elagabal musste eine den römischen eliten genehme frau nehmen · kehrte aber schliesslich doch - das wird im gedicht nicht erwähnt - zu seiner vestalin zurück. Insofern ist Georges formulierung »wie die anderen« auch historisch korrekt: Elagabal hatte drei frauen.
Diese erinnerung wird ohne den versuch einer rechtfertigung · aber auch ohne eine spur der anteilnahme für die vestalin vorgetragen (ihre eigene unerbittlichkeit im Colosseum wo die dem tode geweihten gladiatoren vor dem kampf den kaiser grüssten soll es wol erschweren für sie partei zu ergreifen) und wirkt in den ANDENKEN wie ein fremdkörper. Warum es nicht in die TAGE eingereiht wurde ist nicht bekannt. Vielleicht sollte diese düstere geschichte einer schweren durch mangelndes politisches gespür erfolgten niederlage so weit wie möglich aus zeitlicher distanz erzählt und deshalb zu den kindheitserinnerungen gerückt werden. Ähnlich kann der kurz angebundene und wol zu unrecht als eher kalt empfundene ton erklärt werden. Niemand redet gern unnötig lange über ein peinliches versagen. So erweist sich gerade in der lakonischen darstellungsweise dass Algabal die ganze episode längst richtig zu bewerten weiss.
Das motiv nur vorgestellter perfektion des weiblichen körpers ist aus 201 bekannt. Auch dort können die lebendigen »roten frauen« dem ideal nicht entsprechen ohne dass eine endgültige entscheidung für die eine oder andere seite erkennbar wird. In 051 wird die vestalin gerade umgekehrt wegen der fehlenden jungfräulichkeit - also erneut weil einer abstrakten norm nicht genügt werden kann - verstossen. In beiden fällen wird dieser überhöhte anspruch so wenig wie in ALGABAL durch anschliessendes glück gerechtfertigt. In einer poetologischen interpretation mag man dahinter einen ästhetizismus erkennen der sich der unvollkommenheit des wirklichen lebens verweigert und dafür vollkommenheit in der kunst erstrebt. So wird Georges idee erst sinnvoll dass der erbauer des künstlichen unterreichs gleich alle drei scheidungen mit einem »mal« begründet: die strenge des ästhetischen anspruchs verbietet geradezu beziehungen mit (nie perfekten) menschen und das damit verbundene glück. Das ist nicht als absage an den ästhetizismus zu werten: Algabal hält an ihm fest · verzichtet im gegensatz zu Elagabal lieber auf die beziehungen und geht damit den weg Georges.
Allerdings steht neben der begründung für die retoure der vestalin eine zweite: sie war nur »quell der neuen qual«. Ob damit nur der ärger mit der grossmutter und die politischen wellen gemeint sind die diese ehe aufwarf ist nicht zu entscheiden.
335 Ich will mir jener stunden lauf erzählen:
Sollte nicht was auch immer unter einem feigenbaum geschieht stets als ein augenblick der erleuchtung aufzufassen sein? Dieser feigenbaum wird zumindest darauf deuten dass sich das erinnerte nun wieder auf ein geschehnis in Syrien bezieht wo Algabal zwei »kinder« im schlaf vergiftete die nach dem »unbedachten« geschlechtsverkehr (dass die beiden unterschiedlichen geschlechts sind geht aus »vermählen« hervor) von ihren vätern bestraft worden wären. Er nennt sie deshalb jezt »Begnadete« weil sie aus dem traum ihres glücks nicht mehr erwachen mussten das während des schlafs aus der schönheit ihres gesichtsausdrucks abzulesen war. Die vorstellung dass es wünschenswert wäre nicht erwachsen und unschön werden zu müssen findet sich beim jungen George wiederholt.
Das gift in dem ring war eigentlich für den fall vorgesehen gewesen dass Algabal »bei einer dämmerung« nicht mehr in der lage gewesen wäre »die sterne zu schauen«. Depressionen mit dem gedanken an selbsttötung wären bei jugendlichen deren identität so mannigfachen unsicherheiten ausgesezt sind wie sie Algabal in jener zeit empfinden musste nicht ungewöhnlich.
Auch in Rom beendet Algabal beim rosenfest in 3204 das leben anderer in einem vermeintlich schönen augenblick (sonderbarer zufall: auch dort ging sexuelle aktivität voraus). Die lauterkeit des motivs ist im vorliegenden gedicht eindeutiger erkennbar. Algabal verhindert zugleich mit der väterlichen bestrafung dass die beiden der profanen welt und ihren verboten zurückgegeben werden. Und wenn sie ihn wirklich »kümmerten« wie sonst doch nichts in seinem leben: die seligen kinder sind einfach viel jünger als die festgäste - sie mag er geliebt haben. Man fragt sich ob nicht die unterschiede die parallelen beider gedichte überwiegen: als korrigiere 335 die unklarheit in 3204. Aber wie schon in 3204 lässt Algabal auch hier keine zweifel an der richtigkeit seines tuns erkennen um jeden preis die schönheit eines augenblicks zu verewigen. Bestimmt hatte George selbst auch keine. Sein denken drehte sich nicht um menschenrechte und selbstbestimmung für jeden.
Natürlich könnte man darüber nachdenken ob nicht für den erbauer des leblosen schwarzen gartens der in der sexualität sich artikulierende natürliche wille zum leben den eigentlichen feind bedeuten musste und rosenfest und giftanschlag diesbezüglich einen verdacht auslösen. Der merkwürdige klang von Algabals ungewöhnlich gutherzigen rechtfertigungen - ein leztes laben und liebkosen · der kummer um die kinder - verriete dann dass es sich bloss um spätere rationalisierungen handelt. Algabal ein bewusst bösartiges verhalten zu unterstellen wäre allerdings absurd und liefe auf ein völliges missverstehen der ganzen konzeption hinaus. Edith Landmann notierte die äusserung: »Nicht Nietzsche war jenseits von Gut und Böse, sondern Algabal.« (1963, 100) Denn Nietzsche sei noch ganz in den kampf gegen die christliche moral verstrickt gewesen. Ob gut und böse für Algabal allerdings auch bis zulezt keine bedeutung mehr hatten sei in frage gestellt. Anzeichen für eine gewissensbildung scheint es doch zu geben - die orientierung an der stoa machte sie geradezu erforderlich.
336 Fühl ich noch dies erste ungemach ·
neulich: erneut
Die mit dem giftbefüllten ring angedeutete düsternis seiner lezten monate in der heimat wird hier mit einem frühen und eben auch vorzeitigen sexuellen erlebnis Algabals in verbindung gebracht wodurch »der schönste traum zerbrach«. Das wirft die frage auf ob nicht darin eine nachträgliche rechtfertigung für die vergiftung des liebespaars in 335 zu erkennen sei.
Zulezt wird der tod den er sich im gefühl der enttäuschung in der frühen jugend herbeiwünschte als »sohn der nacht« sogar direkt angesprochen aber mit dem unterschied dass er ihn heute als einen empfindet der eher zu schnell und unauffällig naht (ohne wirklich erwünscht zu sein). »In milder acht« könnte eher mit bestrafung (wie in »acht und bann«) oder geringer achtung oder sogar einer gewissen verachtung zu tun haben wie auch die anrede als »trübster tröster« nur noch ein ambivalentes verhältnis zum tod beinhaltet. Damit wäre eine unter dem stoischen einfluss auch zu erwartende seelische stabilisierung Algabals in der späteren jugend angedeutet. Zugleich wird klargestellt: wenn Algabal nun hand an sich legen wird hat das nichts mehr mit jener jugendlichen sentimentalität zu tun die für die stoa eben keine hinreichende begründung für eine selbsttötung wäre.
337 Ob denn der wolken-deuter mich belüge
seim: blütennektar - hier als bild für den süssen geschmack der lippen eines mädchens
Algabal erinnert sich an weissagungen die ihm durch die deutung der wolkengebilde oder durch seine eigenen beobachtungen des vogelflugs und der eingeweideschau (bei opfertieren) zuteil wurden und von denen er sich nun mehr skeptisch als hoffnungsvoll fragt ob sie gelogen haben könnten.
Diese vorhersagen beinhalteten dass seine lippe von keiner freundin geküsst werde · das von ihm als kerker angesehene leben mit parfüm und verfeinertem essen also einem erheblichen luxus erträglicher gestalten werde · dass diese lippe mit haschisch und wein seine trägheit bekämpfen und dass sie schliesslich verwelken werde während er eine marmorstatue (also vergeblich) um ihre liebe anfleht. M weist darauf hin dass Georges mutter ihrem jugendlichen sohn »ein einsames Wanderleben« vorausgesagt habe.
Es liegt auf der hand dass solche vorhersagen bei Algabal manche schroffe handlung und unbedachte entscheidung provoziert haben mögen wenn er die möglichkeit sah auf diese weise dem vorhergesagten zu entgehen.
338 VOGELSCHAU
Wenn Algabal der sprecher dieser verse ist - und dafür spricht allein schon dass die vogelschau zu seinen priesterlichen aufgaben gehörte und dies unmittelbar zuvor in 337 gezeigt wurde - so hat der tod ihn von allem befreit was ihn bisher fesselte · einschliesslich sich selbst und jeder bedrückenden gedankenschwere. Nun äussert er sich also aller damnatio memoriae zum trotz doch als ein gott - dann aber auf dem Olymp denn für das einswerden mit Elah Gabal ist am ende der wind zu kalt. Oder er gleicht einem Nietzeschen filosofen auf stürmischen höhen. Zumindest aber spricht aus dem gedicht jene reinste leidenschaftslosigkeit die Mark Aurel schon zu lebzeiten erreicht hatte. Sie spiegelt sich in den sich wiegenden · mit dem wind spielenden anstatt sich gegen ihn stellenden schwalben. In der vorrede zum nächsten band wird von der seele des Dichters gesprochen die sich in den anderen zeiten und örtlichkeiten gewiegt habe von denen dort die rede ist.
Der blick ist auf die lebendigen vögel in verschiedenen lebensräumen - wer will mag die wüstenwinde Syriens · die wunderwelt des unterreichs und die schrecknisse der lezten jahre wiedererkennen - und womöglich unterschiedliche jahreszeiten gerichtet. In der gesamtschau war es nun doch ein schönes leben das keine bitternis hinterlässt. Die dunkle beklemmung der dritten strophe wird durch die wiederkehr der hellen schwalben und den wechsel der zeitform überwunden.
Das gedicht gehört aber wol nicht mehr ganz zu ALGABAL (wo es auch keine überschriften gibt) und stellt wieder wie bereits gezeigt eine überleitung zu den folgezyklen dar. Die vogelleichten zeilen wurden vielleicht schon häufiger als erforderlich interpretiert und gern auf frühere oder spätere gedichtbände bezogen. Vielleicht gibt man sich stattdessen lieber damit zufrieden dass es Georges haltung nicht entsprochen hätte den ALGABAL im klageton bedrückender erinnerungen und todesahnungen enden zu lassen - aber durchaus in den wol-lautendsten aller strophen des dritten bands. Dann darf man sich auch die suche nach der bedeutung der geheimnisvollen »Tusferi« ersparen: es klingt einfach schön. Oder es gab doch ein noch unentdecktes leben im unterreich.
Der ALGABAL hat gezeigt dass es wirklich fast sinnlos sein kann Georges zyklen einzelne gedichte zu entnehmen. Gleichwol sind einige wenige auch in den anthologien vertreten. Gewählt werden nicht immer die besten sondern die wenigen die ohne die anderen verständlich erscheinen.
Wolters: 312 · 3205 · 338
Böhringer: 3201 · 3203 · 3205
v. Schirnding: 314 · 3205 · 338
Klett: 314 · 3205
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.