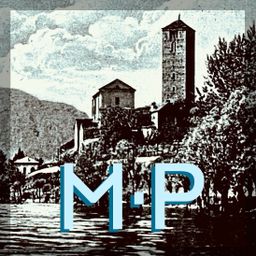Georges Binger elternhaus lag am Nahekai · durch den vorgelagerten garten aber nicht direkt an der strasse. Der eingang war zugänglich über eine schmale gasse: die Hintere Grube (in der mitte der rechten bildhälfte). Der vater hatte es gekauft als Etienne fünf jahre alt war. Mit vierzehn jahren wechselte er auf das gymnasium in Darmstadt wo er auch wohnte. Seitdem kam er nur noch besuchsweise nach Bingen. Nach dem tod der eltern lebte die schwester Anna allein in dem haus. Als sie 1938 starb löste Robert Boehringer - Georges erbe - die restlichen hypotheken ab und schenkte das anwesen der stadt. Sechs jahre später wurde es bei einem bombenangriff zerstört.
"... und nicht nur LECHZEND / Nach tat" (7101): Ein blick auf Stefan George
»Vom Rat der Alten zu berichten, tönt wenig zeitgemäss. Und doch können wir der herausragenden Geister nicht entraten, wenn sich die Frage des Überlebens auf unserm Planeten stellt. Je mehr Europa einer globalen Gleichmacherei entgegentreibt, desto deutlicher hebt sich die Erinnerung an die unverwechselbare, frei entfaltete Persönlichkeit von ihr ab.«
Nicht unter dem eindruck des erst später erschienenen berichts des Club of Rome hat Michael Stettler im frühjahr 1971 · achtundfünfzig jahre alt · das vorwort zu zweiten auflage von RAT DER ALTEN geschrieben. Vierzig jahre zuvor war er von zuhause ausgerissen um - endlich · erstmals - den alten Stefan George im Tessin zu treffen. Seine beiden Schweizer mentoren werden ihm unzählige male vor augen geführt haben dass das nicht so einfach ohne anmeldung möglich sei. Er muss aber geahnt haben wie wenig zeit noch blieb um dem leitstern nahe zu kommen unter den er sein leben längst gestellt hatte. Die rückfahrkarte hatte er in der aufregung vergessen. Die haushälterin wurde überrumpelt und George kannte bereits die ersten gedichte dieses jungen aus Bern. Mit berichten über ihn hatten seine mentoren gut vorgesorgt. Und was der unerwartete besucher jenseits von gut und böse getan hatte muss George eigentlich imponiert haben. Frank · nicht viel älter · durfte ihn hereinlassen und als zu hause die polizeiliche suchaktion nach dem noch minderjährigen begann war der vermisste schon beim hersagen Georgescher gedichte. Zum abschied am nächsten tag gab es geld für die rückfahrt des lezten neuen kreismitglieds und mit Frank einen langen spaziergang am Lago Maggiore · im schatten von San Quirico. Zwei jahre später durfte Stettler bei der geheimen trauerfeier - nur fünfundzwanzig eingeweihte aber keine nazivertreter waren erwünscht - in der grabkapelle von Minusio als der zulezt zum Meister gestossene dem von Claus von Stauffenberg festgelegten protokoll entsprechend den kranz tragen während der noch einmal anderthalb jahre jüngere Cajo Partsch - er war ja schon mit fünfzehn jahren bei George in Berlin - ERHEBUNG 7414 vortrug.
Drei problemkreise nennt Stettler in diesem vorwort. Die frage des globalen überlebens hatte George vor allem in seinem lezten lyrikband DAS NEUE REICH von 1928 zum thema gemacht (besonders in 922). Und um persönlichkeit und ihre bildung sowie das gegenstück - vermassung und egalisierung - drehte sich fast alles in seinem politischen denken seit beginn des jahrhunderts. Der als junge 1931 sich nicht um eltern oder vermeintliche Kreis-regeln bekümmerte blieb insofern auch dreifach an seinem Meister orientiert. Der ton seiner prosa wurde aber ein eigener. Noch näher als die ideen waren dem kunsthistoriker die schönen dinge (die freilich auch in vielen gedichten Georges starke beachtung finden) - damit aber auch die vergänglichkeit. Die natürliche uneitle leichtigkeit seiner aufsätze ist geradezu unverzichtbar angesichts ihrer stillen melancholie wie sie sich bei George oft gar nicht findet oder jedenfalls nur ganz selten das lezte wort behält. Zwar waren diese Alten fachleute wenn es ums bewahren ging - sei es von kunstschätzen · sei es einer sehr alten kirche. Aber müsste man jede von Stettlers skizzen in einem wort zusammenfassen wäre es immer dasselbe: vorbei. Hoffnung wie George sie vielleicht noch haben mochte angesichts dieser jugend um ihn herum geht von dem geistreichen buch nicht mehr aus. Wie auch? · wenn dem autor als persönlichkeiten nur die Alten verbleiben. Und die - er war jedem einzelnen von ihnen persönlich begegnet - sind in seinem buch nur wie ein ältestenrat versammelt. Einen rat aber wissen sie · selbst schon mehr in der vergangenheit lebend · nicht mehr zu geben. Ihre ratschläge waren auch gar nicht gemeint als Stettler von den »herausragenden Geistern« sprach. Wer mit George gross wurde wird nicht auf rettung durch alte leute hoffen - in fragen die nicht durch eine schlacht von Tannenberg zu lösen sind. Stettlers absicht ist angesichts der »globalen Gleichmacherei« die ehrende »Erinnerung« an jene die sich nicht gleichmachen liessen - aber seine erwartung kann nur den jungen gelten wie sie in Georges gedichten meistens die lösung finden während die alten sich ohnmächtig zeigen. Stettler selbst war noch einer von ihnen gewesen die durch ein system von mentoren mit grossem aufwand herangezogen wurden. Um welche haltungen und werte war es bei dieser erziehung gegangen?
So wie sich Stettler mit siebzehn jahren als er sich eigentlich noch als künftiger dichter sah an George orientierte hatte dieser in seiner jugendzeit natürlich auch ältere vorbilder - doch keine deutschen. Auch er reiste - viel längere strecken als Stettler - um ihnen persönlich zu begegnen. Die kosten übernahm der vater aber die sprachlichen kenntnisse musste George sich selbst beibringen. Mit vierzehn jahren schrieb er Petrarca-gedichte ab · mit fünfzehn konnte er sie übersetzen. Durch übersetzungen schulte er gleichzeitig auch seine handwerklichen fähigkeiten als dichter. Die fremdsprachen lernte er leichter und schneller als das dichterische sprechen wie wir es von ihm gewohnt sind. Bis zum zwanzigsten jahr klingen seine gedichte - veröffentlicht wurden sie erst 1901 in der FIBEL - noch wenig eigenständig oder aber unbeholfen. Erst 1889 verhalf ihm die übertragung der lyrik Baudelaires zur entwicklung des eigenen sprechens und im folgejahr erschienen dann als erster band in diesem neuen ton die HYMNEN. Der junge George war kein dichterisches wunderkind und hinter seinen gedichten steckt vor allem arbeit. Er kann in seinen jugendjahren nicht viel zeit mit anderem verbracht haben.
Auch bei den wenigen prosa-übertragungen die 1903 in dem einzigen prosa-band TAGE UND TATEN (und davor in seiner zeitschrift Blätter für die Kunst) erschienen verschwendete er keine zeit mit texten die ihm nichts bedeuteten. Doch was er übersezte war stark genug gewesen um sein eigenes denken zu beeinflussen und trug danach - wie die im weiteren verlauf zitierte lobrede auf den alten turm - seinen unverwechselbaren sprachduktus.
George war kein freund der fortschrittsgläubigen und von kommerz und konsum · technik und wissenschaft bestimmten gesellschaft die das bürgertum seiner zeit zu entwickeln im begriff war. Die zerstörerischen folgen des neuen lebensstils waren ihm schon bewusst - das zeigen mehrere gedichte. Ausschlaggebend für seine ablehnung waren noch ganz andere gründe die in der heutigen umweltbewegung keine rolle spielen. Die massen der modernen lebensform entsprechen nicht seinem am antiken griechentum orientierten menschenbild indem sie ihre banalen träume auf käufliches richten und nach individuellem wohlstandswachstum · sicherheit und unterhaltung nach ihrem geschmack streben. Ihr wichtigstes ist so zu sein wie alle sind und den wunsch nach individualität befriedigt ein tattoo - das haben nämlich auch die anderen. Wenn George diesen typus »bürger« nennt · die romantik sprach passender vom »philister« von dem Eichendorff sagte dass es davon ebenso junge wie alte gibt - so ist damit eine haltung gemeint und nicht einfach eine klasse oder gar das "volk" (ein begriff der im George-Kreis eher positiv besezt war). Den antiken griechen an den der Kreis glaubte verlangt es nach bewährung · wettstreit · hingabe an ein grosses wie staat oder religion. Solch ein höheres kennt Georges »bürger« nicht dem staat und religion nur noch zu dienen haben. Diese bürgerlichen massen schätzen die demokratie. Sie sichert ihnen die herrschaft und verspricht noch mehr wohlstand - bisweilen (zumindest bis 1914) durch krieg und immer durch industrie. Der entgrenzte massenkonsum bewirkt hässlichkeit in vielerlei erscheinungsformen: die billigen materialien die vergammeln statt zu altern · der müll aufgrund der kurzlebigkeit der erzeugnisse · die vernachlässigung der geschmacksbildung und - folgen daraus ebenso wie ursachen dafür - das schrille oder achtlose warendesign (wogegen papier schrift und umschläge von Georges büchern protestierten) · die ablösung der kunst durch den unernst des unterhaltungsbetriebs und schliesslich seelen gesichter und sprache. Georges eigentliche leistung aber liegt in der benennung des tiefsten grunds der modernen perversion: der verkehrung von rechtlosigkeit armut und verzicht des einzelnen in ihr maassloses gegenteil. Um nicht in gefahr geraten zu lassen was als fortschritt bezeichnet wird hatten die versuche begonnen das hässliche für schön zu erklären und das schöne umzubestimmen. Der sieg der von Stettler angesprochenen »globalen Gleichmacherei« wird diesen prozess unumkehrbar gemacht haben.
Vor allem menschenbild und ästhetische ansprüche machen George zum gegner der moderne. Als drittes muss die wissenschaft genannt werden sofern ihr zwei vorwürfe gemacht werden können. Dass das geheimnis und das Heilige aus der menschlichen welt verschwinden - den unabänderlichen niedergang des katholizismus hat er nicht gefeiert - und teile der wissenschaft sich nur noch als vorstufe der technik versteht hat George als bereits eingetretene banalisierung begriffen: "die unermessliche fracht äusserer möglichkeiten hatte dem gehalt nichts (hin)zugefügt · das zu schillernde spiel aber die sinne abgestumpft und die spannungen gelähmt." (T09) Gleichwol bestand der Kreis ja weitgehend aus wissenschaftlern und studenten und George hat mit grossem persönlichen einsatz ihre veröffentlichungen im verlag der Blätter für die Kunst vorangetrieben - verziert nicht mit der sonst üblichen monstranz sondern mit der ebenfalls von Melchior Lechter gestalteten swastika die George schon seit 1916 verwendete (für Gundolfs "Goethe") als es die nazis noch gar nicht gab.
Er verkündete seine einstellung und er lebte sie vor. Ernst Klett hat das in dem zeitlos gültigen nachwort zu seiner anthologie betont: "Er war Gast in vielen Häusern seiner Freunde, angenehm, praktisch, hilfsbereit, zufrieden mit seinen zwei Stoffkoffern, den kleinen Freuden zugetan" (1983, 123). Nie glaubte er die bürger umerziehen zu können - er wollte sie sich nur vom hals halten. In seine lesungen gelangte man nicht ohne eine schön gedruckte einladung. Seine zeitschrift Blätter für die Kunst konnte nicht einfach jeder abonnieren nur weil er dafür zahlen konnte. Die ersten gedichtbände wurden vornehm schlicht gestaltet · in kleinsten auflagen gedruckt und dann verschenkt oder in ganz wenigen von ihm selbst erlesenen buchhandlungen verkauft. Es ist nicht unrichtig aber trivial dies als »Selbstinszenierung« zu bezeichnen - die findet sich schon bei den minnesängern. Doch ist es sehr von heute aus gesehen wenn man alles als »Marketingstrategie« auffassen will. Der begriff missversteht George als eine art popsänger · lässt ihn selbst wie einen bürger erscheinen und beweist nur wie die heutigen in anderen als ökonomischen kategorien gar nicht mehr zu denken vermögen.
Wol haben die bürger zu allen zeiten zurückgeschlagen: in der faschistischen presse wurde er · als die versuche ihn mit posten und ehrungen zu kaufen erfolglos blieben · als verkappter jude und rädchen in der maschinerie der weltverschwörung - und vor kurzem in auffallend ähnlicher weise als alter komödienspieler verspottet dessen anhänger noch in der Bundesrepublik die fäden in verschwörerischen »dunklen netzwerken« zogen (Raulff 2012, 186 sowie im klappentext) · in die erst der journalist Raulff nun endlich licht brachte. Ob jude oder komödiant: unwahr ist beides aber nur lezteres eine herabsetzung. Ernster zu nehmen ist die kampagne die der einst renommierte germanist Osterkamp mit einer ganzen reihe sich inhaltlich wiederholender schriften führte weil sie für von Osterkamp unterstellte menschliche schwächen Georges belege in seinem dichterischen werk zu präsentieren vorgab. Aus seiner triebfeder machte Osterkamp nie ein geheimnis: Georges ihn offenbar beängstigende vorstellung "die Bühne der Geschichte leerzufegen, um auf ihr die Vision einer neuen Welt errichten zu können" (OF 2010, 13). Er verschweigt dass George sich niemals derart überschäzte. Die verändernde kraft seiner lyrik - deren mit keiner anderen zu vergleichende einzigartigkeit gerade darin begründet liegt - kann immer nur auf den einzelnen wirken. Die brüder Stauffenberg mögen als dokument dieser kraft gelten: die "Geschichte" geht gleichwol ihren eigenen weg.
Als nach der jahrhundertwende die gedichtbände zu erschwinglichen preisen und in hohen auflagen · doch immer in sorgfältiger ausstattung erschienen und George in den jahren vor dem krieg von Gundolf und Friedrich Wolters das Jahrbuch für die geistige Bewegung herausbringen liess um die grundlagen seiner weltanschauung vor allem studenten näherzubringen wuchs sein einfluss auf die akademische jugend erheblich. Diese jugendlichen kamen aus dem bildungs- und grossbürgertum sowie dem adel. Die jungen arbeiter und die kirchlich ausgerichtete jugend orientierten sich an anderen leitsternen. Auch wen die technik besonders faszinierte: der wird nicht gerade George gelesen haben. Für George entschieden sich - wenn Victor Frank recht hat - "meist sehr eigenwillige ja trotzige menschen, die vielleicht, wenn sie nicht zu ihm gekommen wären, einen unbändigen stolz und eine unerfüllte sehnsucht schweigend in sich verschlossen hätten" (in: Stettler 1970, 92) wegen seines heroischen menschenbilds aber auch aus einem damals hoch entwickelten urteilsvermögen über die qualität von gedichten · weil sie identifikations-angebote enthielten · aus gefallen an Georges antibürgerlicher haltung · aus begeisterung für griechentum oder mittelalter · weil man an die Weimarer Republik nicht recht glaubte und weil George das gefühl vermitteln konnte zu einer elite zu gehören. Johann Anton hat 1929 dieses glaubens- und lebensgefühl überliefert: »Man wird später die stillen strassen aufsuchen wo mit der morgensonne sich sein fenster öffnete · wo manchmal schon einer der jüngsten wartete · indessen rings die bürger schliefen. Und zahllose wege im weiten vaterland und ruhmlose orte werden nur gelten weil ER dort ging mit seinen drei · mit seinen sieben · mit seinen zehn getreuen.« (1935, 8)
George habe diese zeilen »von seinen jüngern über sich schreiben« lassen raunt Osterkamp (2005, 230) im ton des Eingeweihten ohne zu verraten woher ihm so viel sonst Keinem bekanntes wissen über einen schreibauftrag an gleich mehrere autoren zuteil wurde. Als konnte ausgerechnet Johann Anton · der strahlendste und begabteste im ganzen Kreis und deshalb der Prinz genannt - derartiges nicht aus eigenem vermögen zustande bringen. So strickten nicht nur journalisten vor und nach 1945 sondern auch die germanisten nach 1968 an ihren fantasien rund um den herrischen gebieter über angeblich mediokre speichellecker · die nur auf die einflüsterungen dessen warteten der gar mit dem gedanken gespielt habe »ein Dschingis Khan« (ebd.) zu sein.
Osterkamps geistloser griff in die mottenkiste deutscher angst-stereotype - Wilhelm II. oder der disco-pop der achtziger jahre waren kongeniale vorbilder - ist durch keine äusserung Georges belegbar. Aber gerade die George-germanistik verrät den wissenschaftlichen anspruch gern wenn es der dämonisierung dient - der eine mehr und die andere weniger. Sich an billigen kampagnen zu beteiligen gilt den meisten als opportun solange sie gegen George gerichtet sind. Ein risiko gibt es nicht: über textkenntnisse verfügt ausserhalb der fachwelt niemand mehr - und innerhalb sehen die vielen gleich gesinnten über jede noch so peinliche fehlleistung gern hinweg (belege dazu auf der seite "Lesenotizen: Frauen um Stefan George"). Der rest hält sich bestenfalls heraus: ihnen bedeutet ein George-gedicht so viel wie dem forensiker eine spermaspur. Eigentlich arbeiten alle friedlich zusammen · loben und danken einander wo immer es geht.

Seine weite verlassenheit · seine edle unscheinbarkeit · die so sichtlich aufgeschriebene geschichte seiner jahre ohne jedoch ein zeichen von schwäche und verfall (...) · seine leien und ziegel all erschüttert und zerrissen und doch nicht fallend · sein verlassenes backsteinwerk voll bolzen löchern und hässlichen spaltungen und dennoch stark wie ein nackter brauner felsen · seine gleichgültigkeit gegenüber dem was man für ihn fühle · über ihn denke - keinen anspruch erhebend · ohne schönheit wünschbarkeit stolz oder anmut und doch niemals das mitleid anrufend · nicht wie ruinen sind · nutzlos und kläglich schwach und gern von besseren tagen schwatzend sondern noch nützlich · sein täglich werk verrichtend · wie ein alter im wetter ergrauter fischer der noch immer seine netze wirft . . . so steht er ohne klage über seine vergangene jugend in gebleichter und magerer festigkeit und dienlichkeit · führt menschliche seelen unter sich zusammen · die töne seiner glocken rollen noch zum gebete durch seine risse und der graue giebel wird noch weit draussen im meer erblickt · der höchste der drei die sich über die weite von brandendem sand und hügeliger küste erheben - der leuchtturm fürs leben · der läut-turm zur arbeit · und in dieser zur andacht und geduld. (T116)
Sechs generationen zuvor stemmte man sich noch kraftvoll gegen den gerade erst beginnenden kulturellen niedergang. Der englische sozialreformer John Ruskin stellte der sich entwickelnden industrie die vision einer von handwerk und kunsthandwerk geprägten produktionsweise entgegen - die natürlich mit viel geringeren konsumansprüchen einhergehen muss. Der turm den seine worte ehren ist kein fiktiver. Dass George nun ausgerechnet von diesem sachtext einige seiten übertrug bedeutet viel. Nie wurde in schönerer sprache die idee der nachhaltigkeit gepriesen: trotz hoher ästhetischer wie funktionaler ansprüche bedarf das alte gemäuer keiner erneuerung. An einer einzigen stelle ist zu erkennen dass nicht George der autor dieser skizze war: Der turm sei »ohne stolz« · lobt John Ruskin. Sein begriff des stolzes meint superbia - den arroganten stolz der hochmütigen · in der katholischen lehre eine hauptsünde. Die zentrale tugend ist der stolz bei George. Fünfundsechzig mal findet man das wort in seinen gedichten - schon im ersten vers des ersten gedichts (101) als erstes adjektiv überhaupt. Aber fast immer ist etwas anderes als bei Ruskin gemeint.
Stolz sein bedeutet in der bürgerlichen welt eine tiefe zufriedenheit angesichts dessen zu empfinden was man leistet oder geleistet hat. Wenn wikipedia dazu das foto eines anglers zeigt der stolz seinen fang präsentiert ist das kein gelungenes beispiel: der angler kann sich beim glück bedanken. Das ist bei vielen so die einfach auf besitz stolz sind. Dieser turm aber hat wirklich grund stolz zu sein angesichts des nutzens den er den menschen immer noch bringt · seinem alter zum trotz. Hier ist der stolz eine folge.
In diesem bürgerlichen sinn verwendet auch George das wort manchmal. Aber der eigentliche Georgesche begriff »stolz« ähnelt dem von Nietzsche beschriebenen jasagen zu sich selbst oder wie Victor Frank schrieb dem stolz "des Griechen unter Nichtgriechen" · also "des menschen unter bündeln von empfindungen und trieben" (in Stettler 1970, 75). Deshalb hätte George diesen niemals klagenden turm der jederzeit weiss wozu er da ist · sich seine »dienlichkeit« bewahrt und dem es längst gleichgültig ist »was man über ihn denke« selbstverständlich »stolz« genannt. Dieser stolz ist eine ursache.
Das jasagen zum eigenen so-sein ist das merkmal eines freien oder bei Nietzsche »vornehmen« menschen · frei weil dieser keines niedrigeren bedarf um sich abzuheben und zu definieren. Ein nie lange währender hass ist ihm nicht notwendig fremd - aber anders als der nicht vornehme braucht er nicht den irrationalen hass - rassismus und hass auf juden oder auch nur die anhänger der anderen mannschaft zum beispiel - um sich selbst erst zu konstituieren · sich wie Nietzsche schreibt (Genealogie der Moral 1887) als »einen Guten auszudenken« vor dem hintergrund des ebenso nur ausgedachten Bösen der dann gehasst werden muss. Wenn trotzdem einige George-anhänger sich antisemitisch geäussert haben zeigt sich dass nicht jeder vornehm wird nur weil er George liest. Dass der vornehme nicht des blinden hasses bedarf bedeutet freilich nicht dass er sich für die flüchtlinge oder juden einsetzen muss. Er hilft nicht aus mitleid oder gar nächstenliebe sondern weil er es sich selbst schuldig zu sein glaubt · oder weil er ihn seiner hilfe wert findet.
Reue bis zur selbstzerfleischung habe George - schreibt Frank - ebenso "ekel" empfunden wie vor verzeihen und gnade die beide seiten nur entwürdigt hätten. Georges stolz habe "moderne und christliche menschen erschreckt" (Frank in: Stettler 1970, 74). "Wenn einer etwas angestellt hatte, so erwartete er, dass er dafür geradestand" (ebd.) - durch handeln. Dass es durch die brüder Stauffenberg die den nationalsozialismus anfangs nicht ablehnten zum zwanzigsten juli kam entsprach genau der Georgeschen ethik. Es kann so grundverkehrt nicht sein zu sagen: und die tat entsprang ihr auch.
Der stolz im sinne Georges bedarf keiner erst noch zu schaffenden voraussetzung: weder der anerkennung durch andere noch der leistung · so dass übrigens - bei George ganz entscheidend - schon der junge mensch stolz sein kann (während ihn die bürgerliche welt zu erniedrigen sucht mit der bemerkung er möge erst einmal etwas leisten). Dieses »ja zu sich« ist zuallererst da. "Und unser dasein ist schon tat genug" lautet ein vers von Ernst Morwitz (1974, 34). Vielleicht wird hier der tiefste grund dafür erkennbar dass sich so viele in jugendlichem alter so ausschliesslich und unverbrüchlich zu George bekannten. Geleistet haben sie dann trotzdem ausserordentliches - alle. Dass ein junger kreisangehöriger aus einer strengen auswahl hervorging war zwingend: das konzept war nicht uneingeschränkt verallgemeinerungsfähig.
Das heisst gerade nicht dass er sich selbst unkritisch sehen · gar zum narzissmus neigen darf. Im gegenteil - weil er sich bejaht beobachtet er sich selbst genau: welche seiten meines wesens könnten dieses »ja« womöglich einmal gefährden? Der stolz geht mit einem anspruch an sich selbst einher wie ihn die meisten eben nicht haben. Im tagebuch von Cajo Partsch der den typus verkörpert sind diese prozesse genau abgebildet. Dem fünfzehnjährigen ist wol bewusst warum gerade er vom mentor ausgewählt · warum gerade ihm das treffen mit dem Meister zugesagt wurde von dem so viele andere vergebens träumten. Cajo büffelt ununterbrochen vokabeln - altgriechisch verstanden fast alle im Kreis - und liest in einer woche trotz aller sportlichen betätigungen mehr als ein heutiger abiturient in einem halben jahr nicht schafft. Was er nicht versteht erklärt der mentor. So macht die lektüre sinn: Cajo versucht die gestalten von Plutarch oder Shakespeare zu beurteilen. Er vergleicht sie und er begeistert sich. Dann schreibt er schon eigene texte und lernt gedichte · freiwilllig. Jeder tag verläuft nach einem vorher von ihm selbst festgelegten zeitplan und nichts stört ihn mehr als der zeitverlust durch weihnachtsfeiern oder verwandtenbesuche. Dabei beklagt er ständig seine trägheit. Der bei anderen übliche blick auf die klassenkameraden hätte ihm sicher zum beweis des gegenteils dienen können. Aber sein mentor hatte ihn den anspruch gelehrt und die mitschüler (wie die lehrer) werden im tagebuch nicht einmal erwähnt. Bald sollte er im Kreis auf gleichaltrige mit gleichem stolz treffen vor denen er bestehen musste. Jede seite dieses tagebuchs strahlt stolz und bejahung aus · erst recht seit dem ersehnten ersten treffen mit George im Achilleion.
Der stolz in diesem sinn kann sichtbar sein weil er schönheit verleiht. Georges gedichte vermögen stolz in erscheinung treten zu lassen und lehren oder bestätigen ihn indirekt anhand vieler beispiele ebenso wie ganz ausdrücklich in den ethischen lehr- und zeitgedichten. Schön werden die knaben in ihrem "verschlissnen tuch" als sie - oben auf den klippen stehend - die ihnen von den reichen bürgern der TOTEN STADT (7113) angebotenen edelsteine und schmuckstücke nicht mit den händen zusammenraffen sondern mit ihren nackten füssen ins meer hinunterkicken: niemals darf man sich kaufen lassen. Die schuhe mit dem swoosh brauchen sie nicht um auch einmal stolz empfinden zu können. Verachtung gegen andere zu empfinden die diese höhe nicht erreichen wird bei George nie in frage gestellt. Dass die vergeblich um ihre rettung bettelnden bürger nun dem untergang geweiht sind lässt die knaben kalt.
Als römische variation von Franks "Griechen unter Nichtgriechen" wirft die alte Porta nigra "aus hundert fenstern" den blick der "verachtung" auf die bürgerhäuser um sie herum und ihre modernen bewohner (7106). Nur einem gilt dieser blick nicht: dem von den bürgern verachtetsten von allen · dem strichjungen. George steht oft auf der seite der schwachen wenn sie es wert sind. An diesem wert lässt Manlius nicht zweifeln der in dem gedicht selbst spricht. Man muss sich ihn auch nicht zu unscheinbar vorstellen.
Es mag zutreffen dass ästhetische gesichtspunkte für die aufnahme in den Kreis eine rolle spielten. Gern gesehen war nicht nur die schönheit wie sie sich auf fotos dokumentieren lässt. Bewegung gestik und nicht zulezt stimme und sprache gehörten dazu. Ernst Klett hat das für George unabdingbare so treffend und präzise wie möglich in zwei begriffen zusammengefasst wenn er von "Anmut" und einem "Fundus" (1983, 117) spricht (als dessen wichtigste bestandteile wol begeisterungsfähigkeit und hingabebereitschaft zu nennen wären die George in der glut der augen erkannte. Solche menschen finden sich heute noch · etwa unter manchen sportlern dort wo grosse mühen und hohe gefahr mit geringem honorar einhergehen oder bei den waghalsigen jungen waldschützern. Die begeisterung für das in der eigenen zeit erforderliche auch auf andere zu übertragen mag der tiefere sinn dieser schönheit sein).
Die schönheit ist aber gefährdet. Sie verblasst und schlägt in hässlichkeit um falls der stolz sich in hochmut und seine erscheinungsformen rücksichtslosigkeit und egoismus verwandelt. Der gefahr waren sich George und der Kreis bewusst. Den stolz grenzt deshalb - nicht aus moralischen sondern aus ästhetischen gründen - eine andere tugend ein: ehrfurcht oder scheu. Victor Frank nannte sie sogar "edle demut" gegenüber "allem vollkommenen und vor dem leben selbst, wie vor dem schicksal". Niemand kannte George in seinen lezten jahren so gut wie er · und Frank betont dass George die tugend nicht nur forderte: "Aus seinem leben wie aus jeder zeile seines werkes spricht diese demut und ehrfurcht" (in: Stettler 1970, 74).
Ehrfurcht ist die fähigkeit und bereitschaft die existenz eines höheren oder grösseren ehrend anzuerkennen. In der religion hat der begriff der eigentlich ein Heiliges voraussezt eine grosse rolle gespielt. In kirche und politik konnte er missbraucht werden um schwach gewordene autorität zu stützen. Aus politik und gesellschaft ist ehrfurcht deshalb wo aufklärung wirkte weitgehend verschwunden - die romantik schäzte sie noch einmal. Wenn prominente denker von ehrfurcht vor einem gebirge oder dem sternenhimmel berichteten handelt es sich möglicherweise um eine metafer und weniger eine tugend als ein gefühl. Heutige schüler können auch in der reifeprüfung das ihnen unbekannte oder durch die lehrer ausgetriebene wort oft nicht mehr richtig schreiben. Hans Jonas hat den begriff wieder im ursprünglichen sinn eingeführt und - wie zuvor George - als tugend zu lehren oder wenigstens zu ehren versucht weil umweltschutz ohne ehrfurcht vor einer nicht nur notwendigen sondern heiligen natur nicht umfassend möglich sein kann.
Dass George in der fähigkeit zur ehrfurcht »das Kennzeichen echter Jugend« sah dem er »das entscheidende Gewicht bei der Beurteilung von Menschen« beilegte ist durch Ernst Morwitz bezeugt (1960, 187). Im Kreis wurde ehrfurcht neben ernst und würde zu den "gefährdeten grundkräften" gezählt · das gefühl für sie in der jugend wachzurufen war das erklärte ziel (JfdgB, Vorwort zum ersten Jahrgang 1910). Ehrfurcht ist anders als stolz äusserlich kaum wahrnehmbar wenn man von den religiös besezten und daher für George nicht immer brauchbaren gesten (etwa das knien oder die gebetshaltung) absieht. Die benachbarte scheu ist als tugend bei George keine eigene kategorie. Das wort (es ist auch metrisch unkomplizierter) verwendet er häufiger als »ehrfurcht« und ausserdem natürlich auch im herkömmlichen sinn für schüchternheit vor menschen. Da der fundamentale unterschied zwischen menschen und dem göttlichen bei George aber schwinden kann rücken auch ehrfurcht und scheu zusammen und werden sogar synonym verwendet. Scheu - George nennt sie den »reicheren trieb des edleren tiers« (6213) - birgt den vorteil die gerade dem stolzen notwendige ehrfurcht besser sichtbar machen zu können: der blick »mit gesenktem lid/ So wie man Gott empfängt« (4304) - und dabei die »stirne geneigt« (6213) - ist ein ausweis des schönen stolzes. Auch in einem der prosastücke - ALTCHRISTLICHE ERSCHEINUNG T062 - macht George die in andacht geneigte stirn zur bedingung jugendlicher schönheit. Auf den gestellten staats-fotos die den vergötterten unsterblichkeit verliehen präsentierten gerade die jüngsten den schönen blick. Er wurde fast zur pose: der immer mal ein bisschen rebellische Victor Frank · nach Georges tod mehr denn je inbegriff der treue und orthodoxie - nannte sein foto sogar »scheinheilig«. Der freche spruch deutet auf die bekannte schwäche der für George wichtigen konstruktion : nicht immer ist verlass darauf dass das äussere tatsächlich dem inneren entspricht - daran ändern noch so viele Plato-zitate nichts. - Der kampf gegen die superbia wurde jedenfalls nicht vernachlässigt. Der verlust der ehrfurcht sei ein untreuwerden gegen sich selbst · heisst es in dem gedicht DER ERKORENE 6213. Im tagebuch von Cajo Partsch ist mehrmals von ernsten ermahnungen die rede. Alle wussten im Kreis warum George sogar den liebling Percy Gothein hatte fallen lassen · und ein guter mentor musste seinen zögling vor ähnlicher entwicklung schützen. Es war ja dann auch nicht umsonst. Helmut Küpper konnte auf Cajo ein leben lang - stolz sein. Das war der lohn eines mentors.
Einen stolz ähnlicher art scheint auch George bisweilen verspürt zu haben. Vermuten lässt sich das angesichts mancher äusserungen über Johann Anton. Der schmerz über den tod seines »Prinzen« ist oft beschrieben worden. Aber nie waren die traumbilder der achtziger und neunziger jahre so sehr wirklichkeit geworden wie in der zeit nach 1930. Die furcht des kranken der seinen frühen tod vorhersah vor einem erneuten und nicht noch einmal zu ersetzenden verlust muss gross gewesen sein. Die Stauffenbergs · Frank · Stettler · Partsch - alle untereinander eng befreundet - erfüllten die ganze liste der kriterien und waren (im doppelten sinn) wie die geschöpfe seiner gedichte. Die jahrelange arbeit der mentoren · die jahrzehntelangen dichterischen mühen Georges steckten in ihnen. Als der faschismus jeden von ihnen (nur Stettler war Schweizer) und natürlich auch die älteren aber immer noch wichtigen kreismitglieder wie Böhringer · Walter Anton oder Thormaehlen vor entscheidungen stellte zeigte sich dass der Kreis eben keine diktatur · kein totalitäres system war: die antworten fielen ganz unterschiedlich aus. Dass George mit den über die jahrzehnte zahlreichen jüdischen freunden und seiner abneigung gegen militarismus · massen und fortschritt weder wegbereiter noch anhänger der faschisten sein konnte hätte allen klar sein können. Dennoch begrüssten gerade die jüngeren den untergang der auch von George nicht geschäzten Weimarer Republik. Diese zustimmung übertrugen einige auch auf deren totengräber · in teilbereichen sogar auf ihre ideologie. Aber war es wirklich denkbar dass Frank und die Stauffenbergs ihn wegen politischer differenzen verlassen hätten?
Deutschlands berühmtester lebender dichter protestierte jedenfalls nicht. Doch die von den faschisten ihm angetragenenen ehrungen liess er ausgerechnet durch Ernst Morwitz - den unfassbar mutigen juden - zurückweisen. Keinem deutschen kommunisten gelang - bei aller todesverachtung - jemals eine solche provokation der nationalsozialisten. Ausgerechnet den liberalen demokraten Robert Böhringer machte George zu seinem alleinerben - der erst 1945 wieder deutschen boden betrat. Frank dem Cajo Partsch im auftrag Georges wenigstens den eintritt in die partei ausreden konnte erkannte noch vor kriegsbeginn seinen irrtum und starb 1943 an der front. Anderenfalls wäre er als einer der hauptverschwörer am zwanzigsten juli des folgejahrs erschossen oder vor Freisler geschleppt worden. Partsch selbst - wegen seiner teilweise jüdischen abstammung gefährdet - und Alexander von Stauffenberg der während der naziherrschaft eine jüdin geheiratet hatte überlebten so eben. Berthold und Claus von Stauffenberg bezahlten mit ihrem leben. Und Stettler versuchte sich umzubringen als er in der Schweiz davon erfuhr.
Was die von ihm erfragte persönlichkeit ausmacht sollte damit angedeutet sein. Keiner wird sich gleichmachen · keiner sich noch in der crowd betäuben der bei George gelernt hat. Ästhetisches empfinden ist wol die grundlage für alles und zieht den wunsch nach absonderung und die absage an mainstream und künstlichen bedarf so notwendig nach sich wie der stolz die ehrfurcht. Ganz ohne dafür bereits angelegt zu sein wird vor einem jahrhundert kein vierzehnjähriger begonnen haben in Georges gedichten deren sprache er bewunderte fast unmerklich diese werte zu erlernen - gedichten die nicht nur im klassenzimmer sondern mehr noch auf dem pausenhof einzug gehalten hatten. Wie sich aber ein junger mensch fünfzig oder gar hundert jahre später noch bestätigung solcher anlagen holen soll erklärte Stettler nicht. Warum auch - die gedichte sind ja immer noch da und auch die kostbaren prosa-stücke in TAGE UND TATEN. Auf ihrer wirkungsmacht beruhten die hoffnungen Claus von Stauffenbergs als er nach dem überfall auf Polen in einem brief an Victor Frank (vom 26. 12. 1939) zweifel an Deutschlands zukunft äusserte. "Selbst das Meisterliche Werk würde uns nicht mehr helfen können · wenn es nicht in einigen weiterlebte · so aber kann es und wird es noch wunder wirken." (in: E. Zeller 1994, 76)
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.