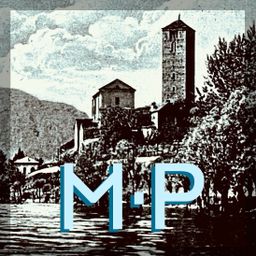7 DER SIEBENTE RING
74 MAXIMIN 7401-21
75 TRAUMDUNKEL 7501-14
76 LIEDER 7601-28
77 TAFELN 7701-70
74 MAXIMIN 7401-21
Der vierte bildet mit einundzwanzig gedichten den mittelpunkt oder von aussen gezählt den siebenten der sieben ringe und so ist DER SIEBENTE RING von den neun gedichtbänden Georges der im zeichen Maximins stehende. Auf Maximilians tod 1904 hatte George schon mit dem gedenkbuch von 1906 und insbesondere der VORREDE T09 reagiert die noch zeichen der unmittelbaren erschütterung aufweist. Nun aber wird die vergöttlichung Maximins nachdrücklicher betrieben wobei eine endgültige klarheit in der frage einer allgemeinen gültigkeit dieser vorstellung über den Dichter hinaus gerade nicht angestrebt wird. Hinzu kommt dass Maximin auch als „gesandter” eines gottes angesprochen wird und manchmal griechischen vorbildern entspricht · ein anderes mal an einen alttestamentarischen profeten oder gar den gottessohn der christen erinnert. Es ist offensichtlich dass George also ein systematisches und widerspruchsfreies religiöses konzept darzubieten gar nicht für erstrebenswert hielt. Wichtiger war ihm offenbar jedem im Kreis eine möglichkeit anzubieten ein für ihn akzeptables bild des verstorbenen in sich zu bewahren - oder der vergottung mit einem feuerwerk unterschiedlicher formen und farben der einen gewissen prunk zu verleihen.
Jedes gedicht mag daher als eine von vielfältigen varianten eines dankes-abtrags (um ein wort Georges aus der widmung der FIBEL zu verwenden) aufgenommen werden den George dem toten geliebten schuldig zu sein glaubte: ein dank für nichts anderes als dessen blosse existenz die jene zuneigung möglich machte mit der sich George aus einer aus der VORREDE bekannten und hier im Maximin-zyklus erneut oft genug erwähnten krise rettete ohne die Maximin Maximilian Kronberger geblieben und heute vergessen wäre. Schon das VORSPIEL 61 hatte ja in ganz ähnlicher weise mit dem rückblick auf eine zeit der niedergeschlagenheit begonnen. Dort war es ungleich weniger heikel dank und hingabe auszusprechen. So mag auch die gesetzeslage ihren beitrag zur geburt Maximins geleistet haben - ebenso wie Georges wunsch den sturm der entrüstung nicht zu entfachen. Die liebe zu dem gott war so wenig verächtlich wie die zu einem engel.
7401 KUNFTTAG I
Schon in der VORREDE wurde mit dem begriff „ankunft” die nähe zu „advent” hergestellt und von T09 her vertraut sind auch die lichtmetaforik und die düsternis in der sich Stefan George (um den es hier so sicher geht wie um Maximilian Kronberger so dass es keinen anlass gibt etwa von einem lyrischen ich zu sprechen) wähnte bevor der junge erschien. Freilich wirft sich die frage auf zu welchem gott er damals betete - und ob nicht das erscheinen Maximins die wirksamkeit des gebets und damit die macht des alten gotts - sei es des christlichen oder (dem beten zum trotz) wie im lezten zeitgedicht 7114 eines mehr numinos-unpersönlich gedachten - mehr bestätigt als es vorgesehen war. Jedenfalls schliesst der eine gott den anderen nicht aus und Maximin kann nie der einzige gewesen sein. Viel wichtiger als alle spitzfindigkeiten ist aber die allem vorangestellte scheinbare klarstellung: ein gott ist Maximin für George - und auf die subjektivität dieses urteils wird scheinbar ausdrücklich hingewiesen: er „sieht” in Maximin den gott der ihn erschauern lässt und dem er nun in „andacht” begegnet. Für andere ist er kind · kann aber auch als freund erscheinen. Alles klingt wie eine anwendung des satzes des Protagoras auf Maximin.
In wahrheit meint dieses sehen nicht die blosse ansichtssache als das unfehlbare sehen des Teiresias denn das empfinden des schauders widerlegt jeden verdacht einer willkürlichen zuschreibung: er ergriff schon den antiken menschen angesichts des erhabenen. Man muss nur „seh” wirklich die ihm metrisch zustehende betonung geben. Das „ich” braucht keine. Denn nun wird ohnehin klar: die anderen „sehen” nichts - weil sie es nicht vermögen. Der seher ist das ich allein.
Es ist fraglich ob der angesprochene noch lebt (wie Wk 2017, 415 behauptet) oder ob er nicht vielmehr in der erinnerung vergegenwärtigt wird - zumal es dem sprecher ja ohnehin immer wieder schwerfällt sich mit der tatsache des todes zu „versöhnen” (7412). Offen gelassen ist der zeitpunkt zu dem die gott-artigkeit Maximins „erkannt” wurde: war das schon zu lebzeiten oder erst nach Maximilians tod? Jedenfalls muss scheinbar niemand George darin folgen: Für seine eltern (mit denen George ja in vertrauensvollem kontakt stand und die er hier noch einmal ausdrücklich berücksichtigt) war er eben ihr kind. Andere - die Maximilian noch erlebten - mögen ihn als freund im gedächtnis behalten. Sind damit wirklich auch jene gemeint die damals George nahestanden und dann gelegentlich auch mit Maximilian zusammenkamen? M denkt wolweislich nur an die mitschüler. Denn für niemanden im Kreis konnte es unerheblich sein wie George etwas „sah”. Was also hier über eltern und mitschüler gesagt wird sind selbstverständlichkeiten aus denen nicht viel gefolgert werden kann: weder dass sie den jungen nicht auch als gott sehen können noch dass sie es müssen. Das galt leztendlich auch für jeden im Kreis der wusste dass es in der tragödie keinem gut bekam den spruch des sehers in den wind zu schlagen. Maximin wie George zu sehen war also jedem nahegelegt - mehr aber nicht. Lothar Treuge der als einer von nur drei freunden sich am GEDENKBUCH beteiligte wurde für sein gedicht herzlich gedankt: „Dich werd ich ob der tränen nie vergessen / Die denen du geweint die ich geliebt” heisst es in der an ihn gerichteten TAFEL (7722). Wie aber George von keinem je verlangte eine seiner privatsprachen zu lernen so ging es ihm auch in religiöser hinsicht nicht um herrschaft und gefolgschaft. Allerdings bleibt die verehrung Maximins in 7410 nicht mehr jedem der freunde völlig freigestellt.
7402 KUNFTTAG II
tritt : betritt
Wie der Dichter seine lage zum zeitpunkt der ankunft Maximilians sieht kommt hier nochmals zur sprache: in den ersten sechs zeilen als bild und in den lezten sechs zeilen mit einer zusammenfassung seines lebenswegs der inzwischen die mitte erreicht also die erste hälfte hinter sich gelassen hat und auf dem er dreimal seine hoffnungen getrogen sah. Als kind suchte er vergebens nach einem vorbild als jüngling vergebens nach einem freund und nun fühlt er wie ihm das vertrauen in sein schicksal verloren gegangen ist. Das bild in dem sich der sprecher durch ein ganzes volk gespiegelt sieht das seinem ersehnten „Befreier” (die gross-schreibung betont die ganze intensität dieses sehnens) das haus wohnlich vorbereitet hat - ein bild im bild - unterstreicht die qual des fruchtlosen wartens und schliesslich die ablösung aller zuversicht durch eine zynische bitterkeit. Es erinnert an die sehnsucht der unter der römischen besatzung leidenden juden die lange auf die wiederkunft des in den himmel entrückten profeten Elia warteten. Ihn wünschten sie sich als „Befreier” - so wie er einst als gottgesandter das nordreich von der herrschaft Ahabs und des baalskults befreite. Ihm öffneten sie am sederabend die tür (im gedicht ist von fenstern die rede) und füllten seinen becher mit wein.
7403 KUNFTTAG III
stammle : konjunktiv des wunsches (so möge dir mein dank gestammelt sein). Das stammeln ist ausdruck des ergriffenseins angesichts des erhabenen.
Der aufschwung den ein mensch durch den geliebten nehmen kann wird hier mit präzision beschrieben (wozu gehört dass George nicht wolkig über liebe schreibt sondern eben über den einen geliebten). Er empfindet seine umgebung wie in einem frühling neu geschaffen - und ebenso sich selbst. Zu verdanken ist das seinem empfinden nach dessen blick dessen hauch dessen herzpochen · also dessen blosser anwesenheit. Diese ernste dankbarkeit wird hier (über T09 hinausgehend) ausdrücklich bezeichnet. Was totenähnlich trocken und starr zu sein schien kommt dem sprecher nun wieder lebendig vor. Deshalb ist es folgerichtig diesen geliebten als schöpfer zu bezeichnen der sich nicht erst wie menschen meinen durch wort und tat sondern durch seinen „hauch” - das ist kaum mehr als seine anwesenheit - als solcher erweist. Man kann die strofe auch etwas anders lesen und „schöpfer” auf Gott beziehen - wichtig ist nur die erkenntnis dass also Gott und Maximin ununterscheidbar werden.
Der gedanke von dieser auch ohne wort und tat „verwandelnden kraft” der „gestalt” findet sich bereits im vierten und fünften abschnitt der VORREDE T09 wo dem hauch auch die berührung gleichgestelllt · zugleich aber die blosse anwesenheit als ausreichend bezeichnet wird. Betont wird dort dass sich diese wirkung auf „alle” erstreckt und die „gestalt” damit mehr bedeutet als ein blosser geliebter (und dieses als schöpfer bezeichnete „mehr” kann durchaus als ein göttliches verstanden werden). Das ist die eigentliche „Entdeckung des Charisma” bei George. Er war froh für das GEDENKBUCH wenigstens einige beiträger gefunden zu haben die ihm seinen preis Maximins beglaubigten. Dessen herz ist „heilig”. Dieses schlusswort ist weder metafer noch hyperbel. Wem der geliebte nicht heilig ist hat keinen.
Die drei KUNFTTAG-gedichte wurden bei der morgendlichen totenfeier am sechsten dezember 1933 von Walter Anton am mit blumen bedeckten sarg in der kapelle vorgetragen.
7404 ERWIDERUNGEN: DAS WUNDER
In allen ERWIDERUNGEN - sie entstanden schon zu lebzeiten Maximilians - denkt sich der Dichter im gespräch mit sich selbst. So meint die frage am anfang eigentlich eine aufforderung an sich selbst nicht mehr wie ein irrender oder gar verwirrter (der er beispielsweise war als er sich noch bei den Münchner kosmikern beteiligte) umherzustreifen sondern sein eigenes privileg zu erkennen dass darin besteht dass ihm durch einen gott Maximilian geschickt wurde - wofür das starke bild des göttlichen feuers im staub geeignet ist.
Das „höchste wunder” ist in jener „kommunion” der geister Maximilians und Georges zu sehen von der im fünften abschnitt von T09 die rede war und die hier als ein zusammenfliessen beider „träume” vorgestellt wird. Das bedeutet zumindest dass George sich Maximin als einen an seinem (Georges) künftigen lyrischen schaffen beteiligten vorstellt.Kronberger erwähnt in einem tagebucheintrag vom februar 1903 mit einiger gelassenheit dass George ihm dieses auf ihn bezogene gedicht zeigte. Offenbar hatte George der selbsteinschätzung des vierzehnjährigen nicht viel hinzugefügt.
Maximin wird hier als „gesandter” eines gottes aufgefasst der lediglich als „er” (beim ersten mal in versalien) bezeichnet wird und dessen offfenbarung George vor der ankunft im gebet erfleht. Die ähnlichkeiten mit der ausgangslage im VORSPIEL ist unübersehbar weshalb es nicht überrascht wenn der engel als vorläufer Maximins oder Maximin als durch die wirklichkeit beglaubigte zweite auflage des engels angesehen wurden. Der musste ja gleich zu beginn vor dem sprecher knien der schon die muse zu führen versucht hatte (101). Den versuch das eigentlich höhere zu dominieren findet sich nun auch hier (diesbezüglich geht es Maximin kaum anders als es Maximilian ging): indem George den gesandten „vorm schreine” seines „jungen traumes” (was nichts anderes als den traum von einem jungen meint - vergleiche dieselbe konstruktion in 7410). beten lässt bleibt Maximin der kniefall wol auch nicht erspart. Sichtbar einverstanden mit kommunion und anbetung ist schliesslich der angeflehte gott: er umlegt des dichters haupt nicht nur mit dem heiligenschein sondern sorgt auch noch einmal für die illumination der abendlichen wolken (auch wenn M nicht zugestehen will dass es die vorstellung einer hand Gottes schon bei George gab) die uns im achten abschnitt von T09 so merkwürdig berührte. Da ist der staat mit seinen gesetzen doch fast schon ausgehebelt.
7405 ERWIDERUNGEN: EINFÜHRUNG
Dennoch bedarf es schon im nächsten gedicht einer neuen list. M spricht hier von einer verschmelzung des engels mit Maximin. Denn der braucht angesichts des brennenden kusses dringend einen platzhalter um jene reinheit zu erlangen die das gesetz verlangt. Zudem ist Maximilian noch am leben. Im kuss aber liegt die eigentliche verschmelzung: er ist der alte musenkuss (aus 101) · der engelskuss (aus 6101) und auftakt der neuen kommunion. Trotzdem klappt es gerade mit der inspiration in diesem gedicht nicht richtig gut. Das üppige rosarot ist die einzige farbe.
7406 ERWIDERUNGEN: DIE VERKENNUNG
Ungewöhnlich bieder klingt auch diese bearbeitung der aus dem Johannes-evangelium (Joh. 20,11-18) bekannten „verkennung” des wiederauferstandenen Jesus durch Maria Magdalena. Der jünger erkennt seinen „herrn” - hier also Maximin - nicht und ist bestürzt über sein versagen. Immerhin verwechselte er ihn nicht mit dem gärtner. Womöglich dachte George auch an die wie mit blindheit geschlagenen jünger von Emmaus (LK 24,13-35) und sprach deshalb vom „blinden schmerz”. Jedenfalls geht es um die überhöhung der eigenen trauer und vor allem Maximins. Dabei entstand das gedicht vor dessen tod der zwar für Kronberger so wenig absehbar war wie für George. Aber wie schon in der VORREDE dargestellt beschäftigte sich Maximilian mit dem gedanken an einen frühen tod. Das mag in George die frage ausgelöst zu haben ob er anders als die jünger Jesu oder Maria Magdalena die kraft hätte an eine auferstehung des toten zu glauben.
Die drei ERWIDERUNGEN wurden bei der morgendlichen totenfeier am sechsten dezember 1933 von Victor Frank vor dem mit blumen bedeckten sarg in der kapelle vorgetragen.
7407 TRAUER I
Angesprochen wird in gedanken der sterbende Maximin erst mit der bitte noch länger zu bleiben und dann mit dem vorschlag den göttern den sprecher anzubieten und dafür Maximin ein irdisches verweilen zu ermöglichen. Dessen entschiedene antwort entlarvt solche gedankenspiele als irrig · verleiht dem leben des sprechers aber einen neuen sinn.
7408 TRAUER II
zeichnet dennoch ein eindrucksvolles bild der leere und sinnlosigkeit die der sprecher nach Maximins tod empfindet. Eingerahmt von zweimal sechs versen steht die anrede Maximins mit ihren ausrufen im mittelpunkt. M erinnert daran dass er im april starb - die natur wird hier also nicht zufällig in ihrer frühlingshaftigkeit dargestellt.
7409 TRAUER III
In der nicht bewältigten trauer nimmt das denken kreisende gestalt an. Dafür stehen hier die beiden immergleichen reimwörter aus denen das gedicht nicht mehr herausfindet.
Die drei TRAUER-gedichte wurden bei der morgendlichen totenfeier am sechsten dezember 1933 von Ernst Morwitz vor dem mit blumen bedeckten sarg in der kapelle vorgetragen.
AUF DAS LEBEN UND DEN TOD MAXIMINS
Mit der überschrift für die sechsteilige gruppe gibt George zu verstehen dass ihm Maximilian bedeutete was Laura für Petrarca war. „In vita e in morte di Madonna Laura” lautet der untertitel von dessen „Triumphi” in den "Rime". Vergleichbar ist die anspielung auf Dantes Beatrice in 7102.
Das erste dritte und fünfte gedicht dieser gruppe wurden bei der morgendlichen totenfeier am sechsten dezember 1933 von Cajo Partsch vor dem mit blumen bedeckten sarg in der kapelle vorgetragen.
7410 DAS ERSTE
Wieder wird zuerst die krise dargestellt die dem erscheinen Maximins vorausging und hier sogar züge eines zu ende gehenden zeitalters trägt (so dass Maximins spätere anrede als „Herr der Wende” in 801 verständich wird). Die träume der freunde zielen in die ferne (das kann räumlich wie zeitlich gemeint sein) und in ihrer endzeitlichen stimmung kommen sie ihrer eigentlichen aufgabe - sie ähneln hier einer priesterlichen bruderschaft die eigentlich über ein heiliges feuer (M) zu wachen hat - nicht mehr nach. Die „verwichne” - George war immer bemüht alte formen der sprache zu bewahren - „pracht” machte sie bisher „beklommen” und liess sie (im empfinden der eigenen unzulänglichkeit) „erröten”: M sieht in ihr sicher zu recht "die Schönheit des Erscheinens der Götter im Mythos der Griechen" die zu erleben den freunden mit der erscheinung Maximins nun unverhofft möglich wurde. Er wird hier ganz aus dem antiken griechentum heraus verstanden.
Der sprecher hat bereits deutlich die funktion des mittlers zwischen ihnen und dem neuen gott den er ihnen ansagt und dessen wünsche er an sie weiterleitet wie in 7414 endgültig deutlich wird. Anders als in 7401 wird hier von ihnen erwartet dass sie sich an der verehrung Maximins (der nicht namentlich genannt wird) beteiligen. In der von ihnen zu preisenden stadt sieht M Kronbergers geburtsstadt Berlin - das George 1902 in dem zu lebzeiten nicht veröffentlichten zeitgedicht über Bismarck DER PREUSSE "die kalte stadt von heer- und handelsknechten" (MB 90) genannt hatte und das er nun als "entsühnt" (M) angesehen habe.
Freilich muss die auffassung nicht falsch sein dass der gott Maximin doch eigentlich erst in München zur welt kam. München war in den ersten jahren des zwanzigsten jahrhunderts viel eher als Berlin die stadt der freunde Georges und das in der zweiten strofe beschriebene erste auftreten Maximilians kann sich keinesfalls auf die geburt eines säuglings beziehen. Um sie dreht sich vielmehr das anschliessende gedicht (in dem sich George noch nach Maximilians tod als in Berlin "fremder" bezeichnet).
7411 DAS ZWEITE: WALLFAHRT
In Berlin wo er studiert und schon 1897 im salon des ehepaars Lepsius gelesen hatte fühlte sich George noch lange als fremder. Seine abneigung gegen die stadt und das preussentum wird hier schon in den ersten zeilen deutlich. Ziel seiner „wallfahrt” - ein halbes jahr nach Maximilians tod - war der Mariannenplatz (heute im bezirk Kreuzberg gelegen) mit dem noch kurz vor der revolution von 1848 entstandenen krankenhaus Bethanien das im südöstlichen stadtteil Luisenstadt ursprünglich im grünen lag - die schönheit des gebäudes und der lage war Friedrich Wilhelm IV. noch wichtig gewesen. Aber zum zeitpunkt von Georges besuch hatte die industrialisierung das romantische empfinden beiseite gedrängt - viel mehr als in Georges München. 1970 wurde das krankenhaus wo einst Fontane als apotheker gearbeitet hatte geschlossen erlangte aber noch einmal berühmtheit als Ton Steine Scherben die besetzung eines nebengebäudes · des früheren schwesternwohnheims besangen das dann als Georg-von-Rauch-Haus für manchen erneut zu einem wallfahrtsziel wurde.
Am Mariannenplatz auf den George durch ein raffiniertes „Kryptogramm” (M) verweist - eigentlich benannt nach einer preussischen prinzessin - war im april 1888 Maximilian zur welt gekommen: von seiner mutter natürlich noch „verkannt” (was hier darauf deutet dass Maximin als von beginn an göttliches wesen aufgefasst wird) wie Jesus von Maria (der tochter der heiligen Anna) - nur nicht von den „drei weisen” (aus dem morgenland) mit denen sich der besucher ein wenig gleichzusetzen versucht.
In der äussersten nüchternheit ist George oft am besten. Hier nennt er den noch ungeborenen sohn Gottes sogar Mariens „last” und er bemüht sich sehr den reiz auch von Maximilians geburtsstätte herunterzuspielen - die prächtige in wirklichkeit durchaus nicht „nackte” eingangshalle und selbst der angeblich „magre” blumenschmuck sind ihm nichts wert - um sie dem kärglichen stall von Bethlehem anzugleichen: „trostlos” und staubig wie dieser wenn auch laut und vom modernen verkehr umtost (das foto oben zeigt den zustand zur zeit der WALLFAHRT). Dabei ist der zum Bethanien gehörige und noch von Lenné geplante park am Mariannenplatz sogar heute noch teilweise erhalten. Es mag nicht ganz belanglos sein dass die himmelfahrt Christi bei dem biblischen ort Bethanien (östlich von Jerusalem) stattfand.
Während Georges „erster jünger” Friedrich Gundolf schon 1899 mit achtzehn jahren zu ihm gekommen war brachte das frühjahr 1905 den beginn der lebenslangen freundschaft mit Robert Böhringer. Im selben jahr begann George sich mit Berlin anzufreunden wo Ernst Morwitz noch zur schule ging ihm im august zum ersten mal schrieb und ihn im november treffen durfte während George gleichzeitig in berührung mit dem Niederschönhausener Kreis kam den einige studenten bildeten. Sie hatten sich ursprünglich an dem historiker Kurt Breysig orientiert · Friedrich Wolters und Berthold Vallentin vor allem sorgten nun aber für eine neue ausrichtung. Das jahr nach Kronbergers tod war das jahr der geburt des Kreises. Ihm gaben die zeitgedichte eine erste weltanschauliche grundlage - für die kultisch-religiöse gemeinsamkeit hingegen mag eine zeitlang die Maximin-verehrung für sinnvoll gehalten worden sein.
7412 DAS DRITTE
bilde : George hatte gleich im anschluss an die erste begegnung fotografien von Maximilian anfertigen lassen.
Der himmlische Maximin erscheint in der ersten strofe als - milder - regent über alle „schritte” des sprechers (der plural ist aufgrund seiner unschärfe geeignet den eindruck einer zahlreichen anhängerschaft zu erwecken) und übermittler des göttlichen worts (M weist auf 922 hin wo der Drud erklärt dass götter sich den menschen niemals „unvermittelt” nahen). Abends jedoch wenn das alleinsein als bedrückend empfunden wird - in der zweiten strofe - ergreift den immer noch liebenden sprecher die erinnerung an den irdischen Maximilian. Der schöne fünfhebige daktylus verleiht der sehnsucht antikische würde.
7413 DAS VIERTE
Auch Maximin leidet als „Verwandelter” - anders als M vorgibt kann in der lezten strofe keine äusserung des noch lebenden Maximilian gemeint sein - noch an sehnsucht doch wird ihm in jeder zeile ein daktylus weniger zugestanden.
Maximilian starb am tag nach seinem sechzehnten geburtstag und damit im april. Hier stellt sich Maximin die reihe der maien vor die er erlebte - sie waren im wesentlichen immer gleich (beispielsweise brachen immer die blatt”knospen” der bäume auf). Dieses dem mai schlechthin wesentliche - natürlich ist der frühling auch ein traditionelles bild für den beginn einer liebe - noch einmal erleben zu dürfen ist sein wunsch . . der so wenig in erfüllung gehen kann wie der des sein bild küssenden liebhabers im vorigen gedicht.
M nimmt dem wunsch Maximins seine raffinierte zweideutigkeit denn „mit euch die mir teuer” sind keineswegs so zwingend wie mancher im Kreis es sich vielleicht gewünscht hätte die irdischen freunde gemeint und schon gar nicht Wolfskehl und Gundolf an welche M denkt · mit denen Maximilian sich aber bestimmt niemals blümchen am wegesrand anschaute. Auch die (im irdischen leben zurückbleibende) freundin könnte mit „euch” angesprochen sein - am ehesten aber die blumen selbst die das knopsen im mai doch täglich erlebten. Nur dann wird in der wiederholung von „noch einmal” in chiastischer anordnung die dringlichkeit der bitte · des fast noch kindlichen bettelns eindrucksvoll hörbar.
Die vorstellung des von der erde (wenn nicht gar vom unterleib?) ausgehenden und daher „unteren” strahls der im vorgang des sterbens und der entrückung mit einem von oben kommenden strahl „tauscht” fand sich schon in 6232.
7414 DAS FÜNFTE: ERHEBUNG
ERHEBUNG : schon im ersten gedicht 7410 dieser gruppe wurde dazu aufgerufen nun „das haupt” zu heben. In kenntnis von 7414 wo Maximin zum ende der trauer aufruft wird deutlich dass George sich schon dort zum mittler zwischen Maximin und einer gruppe machte - dem in den anfängen liegenden Kreis.
bleiches glinstern : abwertender begriff für das schwächliche flackern der während der totenmesse (des „totenamts”) entzündeten kerzen. George geht hier darüber hinweg dass die familie Kronberger protestantischen glaubens war.
zu deines erdentags begehung : zur feier deines lebens (das kurz war und im vergleich mit dem leben als gott wie ein einziger tag erscheint) oder um anlass zu geben dein leben zu feiern
vorm lenzeshauch : angesichts seines tods am vierzehnten april kann durchaus gesagt werden dass Maximilian vor dem beginn des eigentlichen frühlings starb - und angesichts seines alters dass er den frühling seines lebens kaum erst erreicht hatte..
Maximin erscheint hier als göttlicher feuersturm und fordert in seinem „anruf” - geteilt auf die erste und die beiden lezten strofen - die teilnehmer der totenmesse dazu auf erst die tore zu öffnen damit er die kerzen vollends ausblasen und damit das requiem beenden kann und bei der anschliessenden beisetzung das grab mit blumen zu überhäufen als zeichen dass die selbstzerstörerische trauer überwunden ist. Damit wäre der weg frei zur verwirklichung der wichtigsten forderung Maximins: sich mit seiner „neuen form” abzufinden und sie sogar „singend zu gebenedein” was nichts anderes heisst als dass die Maximin-gedichte als teil des kults von Maximin selbst angeordnet wurden. George macht sich hier eindeutig zum mittler zwischen dem gott und den freunden denen er mitteilt was Maximin nur zu ihm gesprochen hat.
Zu dem requiem gehört auch eine vom sprecher gehaltene grabrede. In ihr wird die gegenüberstellung der „glinsternden” kerzen und Maximins „feurigem wehn” abgewandelt zu dem kontrast der kaum sichtbar vor sich hin „glosenden” frostigen lichter mit dem brennenden dornbusch den Maximin zu lebzeiten für den sprecher darstellte: medium der erscheinung des göttlichen wie im zweiten buch Mose. In der würdigung seines leben wird Maximin „spender unverwelkter rosen” (M: „im Sinn von unverwelkbar”) genannt und damit in die nähe des engels gerückt (vergleiche 6101).
Den tiefsten eindruck aber hinterlässt der sprecher mit seinem trotzigen wunsch dass „jeder” aus der erinnerung an Maximilians schönheit und der stärke seiner sehnsucht · vor allem aber aus der zu seinen lebzeiten von Maximin empfangenen kraft seinen beitrag leiste um dessen wirklich „leib”liche ”auferstehung” und lächelnde wiederkunft zu erzwingen (gegen alle natur und - auch wenn es sich um die kraft nicht der muskeln sondern des glaubens handelt - geradezu gewalttätig wie in 7209). Es ist unzweifelhaft dass diese aufgabenstellung keinem wunsch Maximins entspringt sondern der eigenmächtigkeit seines profeten (von dem niemand im ernst erwarten konnte er würde sich mit der rolle eine blossen sprachrohrs je begnügen). Immerhin würde auch auf diesem wege die untätigkeit der stöhnenden schatten umgewandelt in gezieltes handeln und damit in ein gegenteiliges lebensgefühl: „erhebung” meint mehr als die körperliche geste.
Marianne Farenholtz - die mutter des in jungem alter von Victor Frank porträtierten architekten Christian Farenholtz - war der auffassung dass die vorstellung einer geburt "aus des sehnens zuruf" in Frank wirklichkeit geworden war (Stettler 1970, 15). Ähnlich äusserte sich Michael Stettler: für George habe Frank zweifellos "den Maximin-nächsten Typus" verkörpert (1970, 16).
7415 DAS SECHSTE
weiland : einst
glast : abglanz (M)
Wie im VORSPIEL der engel erscheint hier Maximin als freudenbote der den sprecher auf eine schöne insel leitet. M zieht daraus den schluss dass Maximin für George nur eine ganz persönliche bedeutung habe anstatt im mittelpunkt einer neuen und allgemeinen religion zu stehen. Die zweite strofe scheint diese auffassung nur noch zu unterstreichen. Zu den „gütern” Maximins dürften vorrangig die fast vierhundert gedichte zählen die er neben zahlreichen anderen aufzeichnungen verschienster art hinterliess. In den anschliessenden strofen wird er nicht mehr angesprochen sondern in der dritten person „der feierfrohe” und „Helfer” genannt. Seine opferbereitschaft weckte im sprecher die schwache erinnerung an seine eigene jugend in der er nicht anders war. Ganz ähnlich dürfte die vierte strofe gemeint sein in der das bild von dem mit einer armbrust verschossenen bolzen für die fähigkeit steht mit begeisterung zu wirken und solche begeisterung auch zu wecken. Die erneuerung für die der nun wieder in der zweiten person angesprochene Maximin beim sprecher sorgte indem er als „deuter” ihm den blick auf das bisher nur unscharf im nebel sichtbare „Fernenland” öffnete wird in der fünften strofe gepriesen. Auf die „reinheit” der beziehung beider kommt es der sechsten strofe an die ihre bilder daher dem bereich religiöser frömmigkeit entnimmt. Diese reinheit war geeignet andere zu beschämen - dass sie - einmal von Maximin nur angeblickt - zurück ihren „trögen” flohen deutet ihre niedrigkeit ziemlich unverblümt an.
Mit der sechsten strofe endet der rückblickende bericht über Maximins wirkung auf den sprecher. Die lezte strofe handelt im präsens über die gegenleistung die Maximin nun und künftig durch den sprecher empfängt: die kündung seines namens und seine wirkung als helles „gestirn” das auf ewig sichtbar bleibt. George brachte noch 1927 Maximilians eltern dazu von einer eigenen veröffentlichung der werke ihres sohnes - über Georges gedenkbuch hinaus - abzusehen (vergleiche Gremm 2023,12). Der stern sollte nicht aus eigener kraft leuchten.
7416 GEBETE I
drommete : die trompete ist traditionell den höchsten autoritäten zugeordnet und vertritt hier die göttliche stimme.
der Welt beschwerde : Maximin fühlt sich noch frei von allem was anderen das leben schwer macht - dem sündenbewusstsein. Es ist natürlich eine anspielung auf sein alter.
dein mirakel : der altar des gottes. Dort brennt die „weisse flamme” in der Maximin sein irdisches leben opfern möchte.
fachte : entfachte
frei aus starrem lehme : Nach dem Alten Testament und dem Koran wurde der menschliche leib aus lehm erschaffen. Auch Prometheus bediente sich dieses materials. Maximin möchte also das erdgebundene von sich abschütteln und - wie die vorlezte zeile sagt - in feuer oder wasser sich auflösen. Wie George sich diesen vorgang ausmalt zeigt er mit mehr anschaulichkeit in 7421.
fodre : George verwendet häufig das alte verb „fodern”. Der gott soll Maximin sein irdisches leben abverlangen.
Maximin bittet in dem „gebet” seinen gott ihn bald zu sich zu nehmen. Er bemüht sich das bild eines ganz und gar dem gott dienenden gläubigen zu zeichnen. Das beginnt wie bei George üblich mit gesten: der flehend erhobenen hand und dem mund der sich keinem anderen wesen zuwendet sondern allein dem gott dargeboten wird. Er betont wie freudig er sich dem gott opfern würde und wie würdig - weil frei von sünde (was er sogar wiederholt) - er dazu sei. Und er verspricht die pflichten zu erfüllen die sich aus einem verhältnis ergeben das er sich vorstellt wie eines zwischen herrn und gefolgsmann - möchte dafür aber dem gott am nächsten stehen. George verarbeitet hier todesahnungen die ihm aus Kronbergers lyrik vertraut waren und die auch dessen eltern nachdenklich stimmten.
7417 GEBETE II
Das gebet beschränkt sich hier auf die lezte strofe und wiederholt das aus dem ersten gebet bekannte anliegen · verdeutlicht aber seinen eigentlichen sinn: die hingabe des irdischen ist lediglich bedingung des künftigen göttlichen lebens. Das fragezeichen soll den hochfliegenden wunsch ein wenig demütiger erscheinen lassen.
Die anderen strofen scheinen zwar ebenfalls an den gott gerichtet zu sein enthalten aber fragen auf die auch Maximin keine antwort enthält. Zuerst fragt er ob dem menschen nur aufgetragen sei sich in angst vor diesem gott kleinzumachen der als „Furchtbarer der Höhn” angesprochen wird. Dagegen spricht aber dass dieser gott auch die sommer schickt in denen sich der mensch frei und stolz etwa bei sportlichen übungen alles andere als klein empfindet. Dieses lebensgefühl kann sogar dazu führen dass sich der mensch geradezu als „nachbar” des gottes empfindet. Eine solche „helle raserei” erklärt schon M als apollinischen rausch der gestaltende kräfte freisezt (die das jenes durchaus berechtigte „Gefühl der Grösse” erklären) und das gegenteil des dionysischen rausches bedeutet von dem die dritte strofe handelt. In ihm wähnt sich der mensch dem göttlichen noch näher zu sein ja das göttliche „tosen” in sich selbst zu spüren. Zwar ist dieser rausch eine täuschung und wird in der enttäuschung enden - aber der gott „erlaubt” ihn dem menschen doch ebenso. Maximin scheint sich nicht schlüssig darüber zu sein ob diese erlaubnis als grosszügigkeit zu werten sei. Erneut hält sich George hier an vorgaben aus gedichten Kronbergers.
7418 GEBETE III
manch purpurschwellend reis : während die schneeweissen kirschblüten sich schon geöffnet haben sind an den ästen des apfelbaumes die rötlichen knospen noch geschlossen.
der schwärmt und brennt und dräut : der einen (durch die lektüre) für etwas schwärmen lässt und begeistert und einen zur tat treibt
heroen und magier : seine nachmittage verbringt Maximin auf dem wasser mit dem studium der werke oder des lebens mythischer und historischer helden - „magier” die eine welt verzaubern und verändern können (ob man hingegen mit M auch an berühmte künstler denken muss sei dahingestellt) - was seiner fantasie für augenblicke den eindruck verschafft es würden auch ihm deren welten wie ein spielball dargeboten - während in wahrheit sein kahn doch gerade selbst zum spielball der wellen wird. Ironische brechungen dieser art kommen in den Maximin-gedichten nur selten vor.
plane : eine ebene fläche oder wiese. Hier kann man auftreten aufzüge und turniere veranstalten oder sogar schlachten schlagen. Als kontrastierendes reimwort hebt es die schwankende unsicherheit des kleinen kahnes eigens hervor so dass sich Maximin hier erneut ironisiert.
teurer bilder : bilder von menschen die Maximin teuer waren wird er in so geselligen stunden wol nicht an sich gepresst haben. M denkt dass eher dichterische werke gemeint sind aus denen bei zusammenkünften mit George regelmässig vorgelesen wurde was tatsächlich einem „heiligen brauche” gleichkam.
Die fromme gesinnung Maximins wird auch in diesem dankgebet an die sonne gezeigt. Jede strofe gilt einer anderen tageszeit: dem morgen dem vormittag dem nachmittag und dem abend. Wie oft bei George erscheint ein jüngling ohne jegliche beziehung zu mitmenschen. Auch gleichaltrige (Maximilian hatte etliche ihm wichtige freunde) und erst recht die eltern (zu denen Maximilian in einem vertrauensvollen verhältnis stand) spielen keine rolle. Hier erinnert vieles an den der sonne ähnlich zugewandten hirten aus 4104 nur dass hier nichts mehr zu sehen ist von den dunklen wolken die dort noch ihre schatten warfen. Das gedicht hätte als darstellung der in Georges sinn idealen lebenshaltung eines jungen menschen seinen wert auch ohne jeden zusammenhang mit Maximin.
7419 EINVERLEIBUNG
Die vorstellung des sprechers - alllein „im traume” spielt sich ja alles ab - dreht sich um die bevorstehende „einung” oder eben einverleibung die aus ihm und dem entrückten Maximin (der ihm einst wie ein sohn vorkam) ein neues „geschöpf” hervorbringt das sich nun als sohn dieses sohns empfindet. Die eingangszeile beugt klug dem möglichen einwand vor dass Maximins wille dabei übergangen worden sei (noch 8221 scheint eine fast gewalttätige komponente der „liebe” des sprechers einzugestehen). Da beide komponenten „unzertrennbar” miteinander verbunden sein werden ist es undenkbar dass der sprecher künftig noch jemals allein zu tisch oder unterwegs sein kann: Maximin ist immer bei ihm - aber stets als einverleibter, nicht als zweiter. Diese einverleibung wird gedacht nicht als einmaliger vorgang sondern als prozess der sich „immer neu” ereignet . Obwol der sprecher weiterhin von seinem „ich” spricht ist es im begriff ein anderes zu werden. Seine sinnliche erscheinung seine farbe und maserung und selbst sein blut sind dann mit Maximin eins geworden. „Jede faser” des sprechers ist von der fernen lichterscheinung Maximin wie in brand gesezt.
Andererseits ist diese synthese äusserlich doch nicht erkennbar (findet sie doch „im traume” statt) so dass sie eine „geheimste ehe” genannt werden kann (wobei dem begriff der ehe noch ein ganz anderer heute fast unbekannter ernst innewohnt). Die ehe (sie ist der eingangs genannte „andre bund”) dient der zeugung dieses sohnes. Der sprecher sieht sich dabei wie der weibliche teil dessen „verlangen” befriedigt wird indem er in kauernder stellung Maximins „seim” - sein „göttliches Sperma” (Gunilla Eschenbach im Wk 2017, 429) „empfängt” - „immer neu” wie in einem nicht endenden orgasmus.
Der sprecher ist empfangender und gezeugter zugleich. „Keim” und „hauch” verdeutlichen dass das neue geschöpf körper und seele haben wird. Es wird göttlicher natur sein das alles gegensätzliche zu umfassen vermag. Genannt werden hier stellvertretend nur hell und dunkel · freude und trauer. Der gedanke wird auch in 802 807 und 8110 ausgeführt und ist mit einiger kenntnis christlicher mystik - etwa Meister Eckharts - recht gut zu verstehen.
7420 BESUCH
gehäg : grosses buschwerk
im plan : ebene wiese. Hier ist die rasenfläche eines ummauerten innenhofs gemeint so dass die präposition „im” gerechtfertigt ist (M fühlt sich an „den kleinen Garten vor dem Haus in Bingen” erinnert).
Regen sträuche die ruten : die verse fünf bis sieben beginnen mit verben. Ruten sind die zweige der sträucher.
oden : üblicher „odem”. Der göttliche atem kann in der vorstellung des sprechers den etwas zugewachsenen eingang öffnen. Der vorgang erinnert an das vermögen Jesu wunder zu bewirken.
Vielleicht das aufgrund des charmes der ländlichen stimmung anmutigste Maximin-gedicht in variantenreichen daktylen in raffinierter schlichtheit. Eigentlich ist es ein liebesgedicht in dem die stärke der illusion die trauer besiegt. Der wunsch dass der geliebte Maximilian nicht für immer gestorben sei - der ja im grunde auch das vorige gedicht bestimmte - findet hier in der vorstellung seine verwirklichung dass Maximin in der tracht eines pilgers noch einmal für „eine weil” zur erde zurückkehren werde womit ihm natürlich auch eine art gleichsetzung mit Christus widerfährt. Der sprecher fordert sich selbst auf den garten in einen dem frohen anlass angemessenen zustand zu versetzen. Nach der lähmenden hitze des tages - zugleich der zeit ohne Maximin - steht nun der abend bevor in dem das leben wieder erwacht. Eimer sollen schnell befüllt werden um die kieswege die beete den goldlack und die kletterrose zu wässern und zugleich die temperatur dem besucher angenehmer zu machen. Und an der wand vor der eine gartenbank steht auf der „ER” verweilen soll (George ehrt den gott mit versalien wie üblich nur bei der ersten nennung) wächst efeu allzu üppig und muss noch zurückgeschnitten werden. Nur ein gänzlich banaler mensch wird darüber nachzudenken wagen ob sich die arbeit am ende lohnte oder wie gross die enttäuschung ausfiel. Aber der wird ohnehin das gedicht nicht gelesen haben.
7421 ENTRÜCKUNG
blassen · fahlen : verblassen · fahlwerden
Mit der eben noch gefeierten erdverbundenheit ist es schon zu beginn der ersten terzine auf einen schlag vorbei. Wie Anna Katharina Emmerick in Dülmen mit Jesus von Nazareth leidensgleich zu werden sich bemühte versucht George hier die entrückung Maximins (der sie sich ausweislich des ersten der GEBETE 7416 mit nachdruck wünschte) selbst nachzuleben der nun - nachdem er zuerst die qual des trauerns hervorrief - nur noch einen „frommen schauer” erregt. Was dort die wundmale Christi waren ist hier die auflösung der leiblichkeit. Sie beginnt mit dem verblassen sogar geliebter erinnerungen dem die verwandlung in angenehme aber nicht mehr mit irdischem verbundene töne des danks und des lobs folgt während zugleich alles wollen und wünschen erstirbt. In einem steigflug lässt er die höchsten wolken hinter sich bis er sich als teil des göttlichen feuers wahrnimmt oder der göttlichen stimme - die menschen als dröhnen vorkommt weil sie sie nicht verstehen.
Der hinweis auf eine von G. P. Landmann (1974, 158) festgehaltene äusserung Georges „aus späterer Zeit” (SW VI/VII 1986, 219) wonach das gedicht „als ein Vorausfühlen des eigenen Todes zu verstehen” (ebd.) sei ist ohne weitere einordnung eher irreführend weil er den zusammenhang mit Maximin vergessen lässt. Doch lässt er erkennen dass Georges fixierung auf Maximin in „späterer Zeit” nachliess.
75 TRAUMDUNKEL 7501-14
7501 EINGANG
7502 URSPRÜNGE
7503 LANDSCHAFT I
7504 LANDSCHAFT II
7505 LANDSCHAFT III
7506 NACHT
7507 DER VERWUNSCHENE GARTEN
7508 ROSEN
7509 STIMMEN DER WOLKEN-TÖCHTER
7510 FEIER
7511 EMPFÄNGNIS
7512 LITANEI
7513 ELLORA
7514 HEHRE HARFE
76 LIEDER 7601-28
7601 VORKLANG
LIEDER I-VI
7602 I Dies ist ein lied
7603 II Im windes-weben
7604 III An baches ranft
7605 IV Im morgen-taun
7606 V Kahl reckt der baum
7607 VI Kreuz der strasse . .
7608 LIEDER I Fern des hafens lärm
7609 LIEDER II Mein kind kam heim.
7610 LIEDER III Liebe nennt den nicht wert der je vermisst . .
7611 SÜDLICHER STRAND: BUCHT
7612 SÜDLICHER STRAND: SEE
7613 SÜDLICHER STRAND: TÄNZER
7614 RHEIN
7615 SCHLUCHT
7616 WILDER PARK
7617 Fenster wo ich einst mit dir
7618 Schimmernd ragt der turm noch auf den schroffen
7619 Wir blieben gern bei eurem reigen drunten ·
7620 LIEDER I Flöre wehn durch bunte säle
7621 LIEDER II Wenn ich auf deiner brücke steh
7622 LIEDER III Darfst du bei nacht und bei tag
7623 FEST
7624 DIE SCHWELLE
7625 HEIMGANG
7626 Aus dem viel-durchfurchten land
7627 Hier ist nicht mein lichtrevier
7628 Verschollen des traumes
77 TAFELN 7701-70
7701 AN MELCHIOR LECHTER
7702 AN KARL UND HANNA
7703 AN GUNDOLF
7704 ERINNERUNG AN BRÜSSEL: PERLS
7705 GESPENSTER: AN H.
7706 KAIROS
7707 AN HENRY
7708 VORMUNDSCHAFT
7709 GAUKLER
7710 NORDMENSCHEN
7711 ERNESTO LUDOVICO: DIE SEPT. MENS. SEPT.
7712 IN MEMORIAM ELISABETHAE
7713 AN SABINE
7714 EINEM PATER
7715 AN VERWEY
7716 G v. V.
7717 AN CARL AUGUST KLEIN
7718 AN HANNA MIT EINEM BILDE
7719 AN ROBERT
7720 ABEND IN ARLESHEIM
7721 AN UGOLINO
7722 AN LOTHAR
7723 AN ERNST
7724 AN DERLETH
7725 EINEM DICHTER
7726 AN ANNA MARIA
7727 EINEM DICHTER
7728 RHEIN I
7729 RHEIN II
7730 RHEIN III
7731 RHEIN IV
7732 RHEIN V
7733 RHEIN VI
7734 KÖLNISCHE MADONNA
7735 BILD: EINER DER DREI KÖNIGE
7736 NORDISCHER MEISTER
7737 NORDISCHER BILDNER
7738 KOLMAR: GRUNEWALD
7739 HEISTERBACH: DER MÖNCH
7740 HAUS IN BONN
7741 WORMS
7742 WINKEL: GRAB DER GÜNDERODE
7743 AACHEN: GRABÖFFNER
7744 HILDESHEIM
7745 QUEDLINBURG
7746 MÜNCHEN
7747 HERBERGEN IN DER AU
7748 BOZEN: ERWINS SCHATTEN
7749 BAMBERG
7750 TRAUSNITZ: KONRADINS HEIMAT
7751 DIE SCHWESTERSTÄDTE
7752 HEILIGTUM
7753 STADTUFER
7754 STADTPLATZ
7755 JAHRHUNDERTSPRUCH
7756 EIN ZWEITER
7757 EIN DRITTER
7758 EIN VIERTER: SCHLACHT
7759 EIN FÜNFTER: ÖSTLICHE WIRREN
7760 EIN SECHSTER
7761 VERFÜHRER I
7762 VERFÜHRER II
7763 MASKENZUG
7764 FESTE
7765 ZUM ABSCHLUSS DES SIEBENTEN RINGS
7766 EIN GLEICHES: FRAGE
7767 EIN GLEICHES: KEHRAUS
7768 EIN GLEICHES
7769 EIN GLEICHES: AN WACLAW
7770 EIN GLEICHES
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.