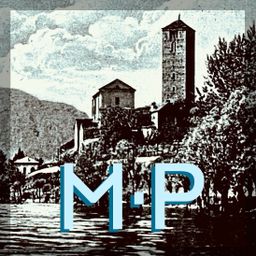6 DER TEPPICH DES LEBENS
UND DIE LIEDER VON TRAUM UND TOD · MIT EINEM VORSPIEL
62 DER TEPPICH DES LEBENS 6201-24
Das zweite buch bietet zahlreiche konkretisierungen des im ersten VORSPIELgedicht verheissenen »schönen lebens« und entwickelt grundlagen der Georgeschen weltsicht.
6201 DER TEPPICH
Sechs verse beschreiben diesen seidenteppich mit seinen zu quästen verknoteten fransen · der mal nüchternen mal üppigen ornamentik um die darstellungen menschlicher tierischer und pflanzlicher wesen vor halbmonden und sternen. Diese wesen sind miteinander »verstrickt« und wie in einem »bund« (ein hochpunkt nach dieser zweiten hebung der zweiten zeile wäre denkbar). Ihr geheimnis enthüllen diese wesen selbst - der zeitpunkt ist nicht vom willen der betrachter abhängig. Wenigen wird es erschlossen - und nur selten · in aussergewöhnlichen stunden · eher des abends als des verstandesklaren morgens. Der intuition verdanken sie dann einen »schatz«. Die grössere gruppe - hier als »gilde« bezeichnet - findet keinen zugang zu dem kunstwerk: auch nicht wenn es durch »rede« erklärt würde. Denn für ein solches steht der teppich · und ganz bestimmt für das gedicht im sinne Georges.
6202 URLANDSCHAFT
hinde : hirschkühe
ried : moor · hier die vom menschen unberührte also noch nicht entwässerte landschaft. Das gras ist hoch und wurde noch nie geschnitten · bietet dem sterbenden hirsch daher auch einen gewissen schutz.
bruch : ebenfalls mooriges oder (auch bewaldetes) sumpfiges gebiet · hier aber bereits spuren der kultivierung aufweisend: er ist gerodet und zeigt ackerfurchen.
George beschreibt ein ganz frühes nebeneinander von natur- und kulturlandschaft. In ersterer leben ausser dem adler (»aar« ist eine früher geläufige dichterische bezeichnung) noch wölfe und hirsche die aber nicht gleichzeitig an die wasserstelle treten. Die hirsche sind scheu und das wolfspaar muss starr stehend und somit eigene geräusche vermeidend seine welpen bewachen. Das sterben ist teil dieses nicht idealisiert dargestellten lebens.
Unbeschwerter geht es in der welt der beiden menschen zu. Mann und Frau erscheinen hier als stammeltern eines künftigen volkes und der optimismus des anfangs lässt sie froh alle mühen ertragen. Dass erzvater sich beim umgraben vielleicht etwas mehr anstrengen muss als die frau beim melken · dass die tätigkeiten so konventionell festgelegt sind fanden manche interpreten süffisanter bemerkungen wert. Hätte George die rollen allerdings umgekehrt verteilt wären die kommentare wol noch empörter ausgefallen. Man wird ihm aber nie verzeihen dass erzmutter vom baumfällen ausgeschlossen war. Warum nur zeigte er nicht vater und mutter im teamwork vereint bei der fellpflege des viehs - und zuvor in der herbeiführung eines konsenses im auf augenhöhe geführten diskurs über eine zielvereinbarung · alle relevanten faktoren der partnerschaftlichen führung des gemeinsamen agrarwesens betreffend?
Warum sich aber der verzicht auf die heuernte im ried verträgt mit der haltung von milchvieh - diese frage hat noch keinen unserer germanisten umgetrieben.
6203 DER FREUND DER FLUREN
fähren : ackerfurchen
hippe : sichelartig gebogenes messer
herlinge : unreife weintrauben in einem frühen stadium
quecken : tief verwurzeltes hartnäckiges unkraut
Das gedicht wird oft genannt als beleg für die nähe Georges zur bäuerlichen welt seiner Bingener heimat. Zumindest beweist es die wertschätzung die George denen entgegenbrachte die ihre landwirtschaftlichen arbeiten mit liebevoller hingabe verrichten. Allerdings wirkt dieser landmann - das zeigt besonders das giessen mit einem ausgehöhlten kürbis - wenig aufgeschlossen für moderne arbeitsformen mit maschinen und dürfte sich auch für eine optimierung des betriebs-ergebnisses kaum interessieren. Zeitdruck ist ihm fremd. In aller ruhe bewirkt er doch - zulezt wie ein mensch gewordener fruchtbarkeitsgott erscheinend - ein umfassendes blühen · und schliesslich »schwellen« aller früchte. Denn spezialisiert hat er sich noch keineswegs: in der ersten strofe wird er als ackerbauer · in der zweiten als weingärtner und in der dritten als obsterzeuger gezeigt. Zwar mag der weg bereits begonnen haben der schliesslich bis zu jenem arroganten menschen führt den der drud in 922 so bitter zurechtweist. Doch lastet nicht die schuld auf ihm der ja noch keineswegs »das band zerrissen hat mit tier und scholle«.
Das geheimnis seines erfolgs liegt freilich schon in »weisheit« und »künsten« (ebd.): er weiss wie man den richtigen zeitpunkt der kornernte herausfindet · welche triebe der weinrebe des anbindens bedürfen und welche trauben die kraft der pflanze überfordern würden · welche jungen bäume vor dem sturm einer stütze bedürfen und wie stark das unwetter wol ausfallen wird. Aber seine gefühle schliesst er nicht aus (anders als der mensch in 922 der sich nur noch auf »geist« und »ordnung« beruft) und eine lieblingspflanze wird besonders beachtet. So ist es nicht weit hergeholt wenn manche interpreten hinter dem agrarischen szenario ein eher pädagogisches konzept erkennen wollen. M macht darauf aufmerksam dass eine entsprechende gleichsetzung schon bei Plutarch vorkommt. Ernst Morwitz’ schüler Bernhard von Uxkull hat George selbst als den erkannt der sich hier als FREUND DER FLUREN maskiert. Die verse des sechzehnjährigen dichters erschienen posthum 1919 in den BfdK (11/12, 267) als erstes gedicht des rasch legendär gewordenen STERNWANDEL-zyklus (und 1964 in einer von Morwitz besorgten eigenen ausgabe):
Das tiefe auge voll von gluten hält/ Die grosse schau - und schwere blicke schweifen/ Von den verdorrten früchten zu den reifen . . / So schreitet wohl der landmann durch sein feld.
Die halme lauschen dem geliebten schritt /Und bäche dämpfen ihren wellenschlag./ Er segnet froh doch seufzend. Denn er litt/ Ein leben lang für diesen sommertag.
Die schweren falten seiner stirn erhärten · / Weil sie der grosse ewige strom gewellt . . / So schreitet wohl der landmann durch sein feld . . / So schreitet wohl ein fürst durch seine gärten.
6204 GEWITTER
sie zu versichern : sie zu bewältigen
festet : festhält
Das motiv des gewittersturms sorgt für den anschluss an die vorangegangenen verse. Es erscheint als ausbruch unbändiger leidenschaft: die »falsche gattin« - sie verhält sich nicht wie eine gattin - die dem schutz des gatten zu entrinnen sucht riskiert sich »zügellosen rettern« auszuliefern und geniesst die situation gleichwol. Die irrationalität und verstörende sinnlosigkeit der naturkatastrofe - das personifizierte unwetter ähnelt mit zähnen mähne und in der nacktheit mehr einem tier als einer frau - ist lesern unserer zeit eine zugleich bedrückende und vertraute erfahrung. Das verständnis dafür dass ihr nur mit unerbittlicher tatkraft zu begegnen ist dürfte in neuerer zeit gewachsen sein. Ob es deshalb unbedingt eines »strengen königs« bedarf dürfte die eigentliche frage sein. Immerhin schluchzt die mit lezter kraft besiegte am ende nicht mehr: lieb- und mitleidlos gewinnt sie die fassung rasch zurück - im wissen dass keine haft den nächsten ausbruch wird verhindern können?
Hingegen hat schon M hat gezeigt wie dieses gedicht in der äusserlichen handlung einfach den vorbildern antiker und nordischer sagen folgt in denen eine männliche gottheit - Zeus oder Odin - die weibliche - Hera oder Freia - unter kontrolle bringen muss.
6205 DIE FREMDE
torf : torfmoor
lein : leinwand
im hornungschein : im februarlicht
Es erstaunt wie naiv die germanistik - die doch um jeden preis stets »kritisch« erscheinen möchte - auf die auskünfte hereinfällt die ein unzuverlässiger sprecher hier an den mann zu bringen versucht. So wird aus der aussenseiterin noch immer wie einst bei M eine hexe und das dörfchen gar ins mittelalter versezt (so zulezt Wk 2017, 283) · was leider gleichbedeutend ist mit der verharmlosung des George-gedichts zu einer trivialromantischen Uhland-ballade.
In der zeit Georges - also nicht lange vor dem faschistischen genozid - gab es noch fast überall die bevölkerungsminderheit der zigeuner. Ausgrenzung und verachtung schlugen ihr immer entgegen · lange vor 1933 · und auch in Georges versen wird nie ein wort mit der einsamen frau gesprochen. Allgemein bekannte merkmale ihrer kultur werden im gedicht auch dieser FREMDEN zugeschrieben: die farbenfrohe kleidung · die nähe zur musik · das wissen um heilkräuter und wahrsagerei. Und sie kommt aus »fernen gauen«. Das ist kein merkmal von hexen - wol aber der ziganen einwanderer.
Egyptien aber verschärft die auf gerüchten und vorurteilen basierende ausgrenzung - die das gedicht ja gerade brandmarkt - sogar noch wenn er das harmlose wesen »dämonisch« nennt (ebd.). Dabei versteht sich doch gerade bei George von selbst dass er immer auf der seite der verfemten minderheit stehen · sich mit der aussenseiterin identifizieren und bei einer solchen konfrontation niemals den standpunkt der selbstgerechten mehrheit teilen wird zu der sein nur scheinbar neutraler sprecher aber erkennbar gehört.
Dieser sprecher verwickelt sich in widersprüche und legt bewusst die falsche fährte indem seine zigeunerin - wortgleich wie die hexe im märchen - »sott und buk« (was doch nichts anderes heisst als dass sie kochte und backte - wie jede hausfrau aus dem »volk«). Ihr kind hat das tiefschwarze haar der zigeuner und die helle haut der mehrheitsbevölkerung. Aber wie wurde es gezeugt wenn doch angeblich niemand sich auch nur ihrem haus zu nähern wagte? Die behauptung wäre wol geeignet um jede beteiligung eines dorfbewohners an der aus reinstem FREMDEnhass erfolgten vergewaltigung zu leugnen (die wegen der aussenseiterposition des wehrlosen opfers so wenig riskant war wie später die übergriffe in der sogenannten pogromnacht). Wozu dann aber die verschiebung der schuld (die also über die verweigerung aller sozialkontakte sicher weit hinausgeht) auf die frau der angeblich nachts mit ihrem »offenen haar« (und welche frau trägt nachts ihr haar nicht offen?) und ein bisschen gesang · sonntags in buntem rock freundlich zum fenster hinaus lächelnd bei biederen »gatten und brüdern« die »Entfesselung der Triebe« (ebd.) gelang? Mit dieser harmlosen show soll das arme weiblein das Egyptien allen ernstes »dämonisch« findet (ebd.) tatsächlich eine »elementare Gewalt« entfacht haben (ebd., 284)? Das kann nur glauben wer sein leben zwischen hörsaal und caféteria verbrachte. Dort sollte man aber wenigstens zwischen original und parodie unterscheiden können. Einem romantischen dichter hätte man die männermordende sirene noch wohlwollend abgenommen. George aber gibt doch gerade zu durchschauen dass sein unbeholfener sprecher nur eine zur karikatur missratene kopie der damals überall bekannten Lore Lay zustande gebracht hat · eine kopie die nie und nimmer den männern zum »verderb« gereicht haben kann - die sich doch angeblich nicht einmal in die nähe ihres hauses wagten !
Die widersprüche thematisiert der sprecher sogar selbst wenn er die unterschiedlichen versionen zum verschwinden der frau präsentiert die doch nur ins ungewisse verlagern sollen dass die geschändete durch isolation und dämonisierung in den freitod getrieben wurde. Ein moor ist selbst heute noch bei manchem selbstmord behilflich. Das absurde verschwinden »auf dem mitten weg« verrät hingegen das bedürfnis des dorfs nach entlastung. Da versteht man schnell wie es dazu kommt dass sie zwar das heilkräftige ranunkelkraut sammelt (womit zigeuner tatsächlich warzen behandelten) - in gefährlicher bösartigkeit (frei erfunden wie die jüdische brunnenvergiftung) aber angeblich auch den attich (den sehr giftigen falschen holunder der freilich auch die selbsttötung unterstützen konnte): alles beruht nur auf gerüchten die wie üblich aus einem teil wahrheit und vielen fantasievollen zutaten bestehen. Wer soll denn wirklich gesehen haben welche kräuter sie unmittelbar vor ihrem verschwinden angeblich noch sammelte - »im dunkel« und ohne sich ihr genähert zu haben? Der sprecher aber - frei von jeglichem interesse an der wahrheit - betreibt mit der ungefilterten wiedergabe des geredes das geschäft der verschwiegen-verschworenen schuldigen · der mitläufer und -wisser. Und ist damit erfolgreich bis heute. Da hilft es nicht wenn die germanistik zu recht die sprachliche »Simplizität« (ebd.) des sprechers konstatiert - und ihm dann trotzdem blind auf den leim geht. Die lezten drei verse zeigen allerdings eine ganz andere · mehr dichterische sprache. Hier gibt - durch zwei trennende punkte deutlich markiert - ein hörbar anderer sprecher den hinweis aus dem sich die gewalttat schliessen lässt.
So befindet sich Egyptien leider auch in schlechter gesellschaft. Natürlich hat sich Osterkamp begierig der FREMDEN bedient - und des dubiosen sprechers den er sich zum komplizen zu machen sucht anstatt ihm bloss zum opfer zu fallen. George »stößt mit lässiger gebärde die fremde Frau in den Schlund« behauptet er · unterstellt ihm damit ein billiges revanche-foul für den vermeintlichen mord am blumenelf (was nur versteht wer seine fehldeutung von 0117 kennt) und belegt offenbar völlig naiv mit den worten des sprechers: »Da sah man wie sie sank im torf« (2010, 271). Mag Osterkamp ein ganzes buch geschrieben haben über »Stefan Georges poetische Rollenspiele« (2002): im entscheidenden augenblick versteht er nichts und sezt George und den sprecher wie ein fünftklässler in eins. Das ist nicht schlechte · es ist überhaupt keine wissenschaft. Selbst die basics sezt Osterkamp ausser kraft - wenn es seiner propaganda nützt. Und das ist noch nicht das schlimmste.
Denn wie ein windiger strafverteidiger macht auch der germanist das opfer zur täterin wenn er die »bunte Fremde« flugs zum »Inbild der Hure« erklärt (ebd., 270): die schmierigen dörfler · endgültig von aller schuld befreit · reiben sich die hände und ernennen zum dank für das vereinte victim blaming den sprecher und seinen komplizen zu ehrenbürgern ihres verkommenen fleckens. Belastet wird nun ganz allein die vergewaltigte Tote - und alles nur damit Osterkamp seine tumbe schlagzeile mit neckischer alliteration garnieren kann: das immergleiche mantra vom misogynen George der nun im TEPPICH frauen nur noch als »Heilige" - oder als »Huren« (ebd.) zu entwerfen vermöge. Misogyn aber ist allein Osterkamps germanistik die sich für die FREMDE nicht im geringsten interessiert: nicht wahrnimmt wie sorgfältig sie als zigeunerin (und nicht als hure) entworfen ist · gleichgültig ignoriert welch einsames leben die bürger ihr aufzwingen · und sich schon gar nicht fragt warum sie aus ihm scheidet - ist sie ihm doch schließlich nur die hure. Diese germanistik ist nicht nur misogyn. Sie ist überhaupt inhuman. Und sie ist unfassbar schlecht: was soll denn das für eine hure sein - wenn alle männer vor ihr nur »grauen« empfinden? Dieses »grauen« aber ist nichts anderes als die unerträgliche verunsicherung durch das fremde. Erst die vergewaltigung setzt ihr ein ende: indem die zigeunerin mit dem kind zur scheinbar käuflichen nutte entwürdigt wird der schliesslich nur noch der gang ins moor bleibt.
Schriftsteller die nach 1945 die mechanismen von ausgrenzung und schuldverschiebung · fremdenhass und volksgemeinschaft wortreich aufdeckten und beklagten gab es viele. Das garantierte noch fünfzig jahre danach den beifall des feuilletons und sichere tantiemen. Dieselben fünfzig jahr danach begann man den zusammenhang von rassismus und sexueller gewalt zu begreifen. Hundert jahre davor hatte der Dichter das alles längst dargestellt - in vier knappen (und hier sogar nur vierhebigen !) vierzeilern. Ihm hat es keine anerkennung eingebracht. Gefeiert werden nur die germanisten die den blick dafür noch heute verstellen.
6206 LÄMMER
Diese lämmer sind gerade nicht jung und sie sind auch nicht wie übliche herdentiere gänzlich ununterscheidbar. Manche sind träge · andere aber behende · manche vorsichtig · andere wagen sich auch auf abhänge. Manche besingen eher die »sonnenlust« · andere die »mondesschmerzen«. Aber zusammen gleichen sie doch einer herde. Denn gemeint sind jene dichter die dem sprecher als »Alternde» gelten: die vertreter der vorigen generation deren kaum noch lebendige werke »fahl« geworden und »halbvergessen« sind. Alle laufen in die gleiche richtung · bewunderten klassikern folgend deren »güldne glocken« immer noch den ton angeben. Innerlich sind sie · in ihrer erinnerung dahindämmernd · »leer« und für die heute jungen zu denen sich der sprecher zählt kaum noch begreifbar geworden (so dass das wort sich ab der zweiten nennung nicht mehr in das jambische metrum einfügt). Am schärfsten klingt der vorwurf dass sie an der »wohlumfriedigten zisterne« ihre zufriedenheit finden und das »ferne« Neue scheuen wenn es mit unangenehmem verbunden ist das ihnen »schrecken« einflösst. »Lämmer« werden sie also auch wegen ihrer harmlosen belanglosigkeit genannt die keine glut mehr entfachen kann.
6207 HERZENSDAME
küster : der mesner oder hausverwalter des kirchengebäudes
gnadenbild : in der katholischen kirche ein kunstwerk das die heilige Maria oder andere Heilige darstellt. Ihnen wird die kraft zugesprochen Gott gnädig zu stimmen weshalb es sinnvoll ist in ihrem beisein - also im beisein der gnadenbilder - zu beten. Der schritt zum aberglauben ist spätestens dann getan wenn sich die gläubigen sogar vorstellen das gnadenbild selbst sei körperlich lebendig geworden. Wie schon in 0306 sind auch hier gerade die frauen fromm - aber wie jede im augenblick des vermeintlichen wunders nur angst um sich selbst hat wirkt befremdlich. Nach der deutschen dichtungstradition erscheint damit auch die kirche als eine erlöschende kraft. Diesmal aber wird der herde eine persönlichkeit entgegengestellt die sich von der - übrigens durch das versagen eines mannes ausgelösten - hysterie der menge nicht anstecken lässt und ihre haltung bewahrt. Anstatt sich niederzuwerfen »schreitet« sie und neigt ihr haupt nur leicht. Dabei ist sie alles andere als eine aufgeklärte gestalt denn auch sie »fleht« und vermag in »Verzückung« zu geraten.
Es ist bezeichnend für das Georgesche denken dass wir nicht erfahren ob diese dame eine beruhigende wirkung entfaltet. Die grosse persönlichkeit steht einsam ganz für sich - und der besinnungslosen menge ist nicht zu helfen. Ihr gilt Georges interesse nie. Das gnadenbild aber offenbart sich nur der dame. Die botschaft an sich muss im gedicht gar nicht ausgesprochen werden. Auch dieses muster wird sich bei George noch oft finden lassen. Ins unscharfe gerückt wird auch die anfängliche abwertung der kirche die in der erscheinung der dame erheblich gemildert wird.
6208 DIE MASKE
puppen : geschlechtsneutral · hier »Verpuppte« also Maskierte (oder stark Geschminkte)
mehle : hier für gesichtspuder oder make-up
aus scherzendem jahrhundert : die in seide gekleidete vornehme (hof?)gesellschaft lässt sogleich an das (schon in 112 angedeutete) zeitalter des Rokoko denken als maskenbälle in mode waren. M berichtet von einer zugespizten äusserung Georges wonach Watteau den rokokostil in seinen gemälden geradezu erst ersonnen habe. Gleichwol handelt es sich wie üblich nur um eine historische einkleidung. Es geht nicht um das Rokoko sondern die einsamkeit des aussenseiters in der gedankenlosen menge : das thema des vorigen gedichts wird also lediglich variiert.
Fast schon eine kleine ballade in der die erfahrung eine rolle spielt dass der einzelne in der gruppe - der »leichten (also leichtfertigen) schar« - zur anpassung neigt und die initiative scheut: niemand vermisst die person die sich absonderte winkte und nicht zurückkehrte. Und später gibt man sich mit oberflächlichen erklärungen für die merkwürdigen geräusche schnell zufrieden. In der gegenüberstellung von wertloser menge und dem sich nicht ein- oder unterordnenden einzelnen bildet das gedicht einen wesentlichen baustein zur grundlegung des Georgeschen weltbilds.
Der maskenball dürfte während der faschingszeit stattfinden - das eis des teichs ist auch schon brüchig geworden. M denkt an den »Karneval des Lebens« so dass vieles dafür spricht dass die person die sich nahe »am aschermittwoch« wähnt mit dem gedanken das fest verlässt im eisigen wasser einen schnellen tod zu suchen. Das winken wird so zur tragischen geste.
6209 DIE VERRUFUNG
»In diesem Gedicht liegt eine Anerkennung des Talionsprinzips, das sowohl von den Völkern des ›Alten Testaments‹ als auch von den Griechen für gerechtfertigt erachtet wurde.« M erinnert zudem an 6108 mit einer ähnlich zustimmenden bewertung legitimer rache. George hat ja die vergeltung der vergebung und dem mitleid immer vorgezogen · allein schon weil nur so die würde des gegners gewahrt bleiben konnte.
Der anfangs zu sich selbst redende reiter folgt dem fluss in richtung der sümpfe denen er entspringt. Die landschaft spiegelt sein vom wunsch nach rache aufgewühltes innere. Ein sprecher bestärkt ihn in der auffassung dass nur der tod des gegners ihm ruhe verschaffen könne. Dazu entwirft er mit grosser anschaulichkeit die vorstellung des unschädlich gemachten Erdolchten dessen leiche den fluss hinabgeschwemmt wird und dabei dem reiter entgegenkommt.
Das bedeutet freilich dass nicht der reiter zur gewalt griff. Sein handeln beschränkt sich auf das (ver)«rufen« · also das verfluchen. Die kunst des gedichts besteht darin dass die bloss vorgestellte von einer tatsächlich im wasser treibenden leiche nicht mehr zu unterscheiden sei: entscheidend ist doch nur die in beiden fällen gleichermaassen mildernde wirkung. Fantasie (oder kunst) hebt die eigentliche gewalt auf. Ohne dass der rachegedanke einer christlichen vergebung zuliebe geopfert oder an eine staatliche institution abgetreten werden muss verliert der berüchtigte alttestamentarische rechtsgrundsatz seine unmittelbare gewalttätigkeit (und ungesetzlichkeit). Georges kunst ist humanistisch.
Recht naiv erscheint die vorstellung des Werkkommentars wonach George im ernst daran geglaubt habe die blosse verrufung reiche aus um einen lebenden mittels »Sprachmagie« (2017, 288) ins jenseits zu befördern - als sei George eine art esoteriker gewesen. Wol aber weiss er von der macht des aberglaubens. Die lässt er bestehen. George ist kein aufklärer · kein Atatürk (und nichts gibt ihm heute mehr recht als dessen scheitern).
6210 DER TÄTER
ist der entwurf einer der fundamentalsten vorbild-gestalten überhaupt und steht insofern neben dem HIRTEN 4104 einerseits und den folgern andererseits: dem WAFFENGEFÄHRTEN 4307 und dem JÜNGER 6212.
vorm vergessenen fenster : »weil ›Der Täter‹ auf die Tat konzentriert es lange nicht benutzt hat, um in die Landschaft zu schauen« (M). Vielleicht hatte er es auch nur zu schliessen vergessen.
was unentrinnbar in hemmenden stunden mich peinigt: ein hinweis auf die skrupel die den täter zögern liessen. Ein gewissenloser verbrecher ist er eben gerade nicht.
die wahllose menge : was Herbert Marcuse 1964 den »eindimensionalen Menschen« nannte war George schon lange bewusst. Wer das gegebene gedankenlos hinnimmt und alternativen für so undenkbar hält dass er sie tatsächlich nicht einmal denkt - der ist »wahllos« und sein »gedachtes« nur »dünn«.
Dem der von des schierlings betäubenden körnern nicht ass : den Sokrates liess die (für eine kurze zeit von den demokraten gesteuerte) Athener regierung bekanntlich zum tode verurteilen. Platon hat die einzelheiten im Kriton genau überliefert: der tod wurde herbeigeführt durch das gift der schierlingspflanze (conium maculatum). Aus deren hier »kömer« genannten früchten wurde der trank hergestellt den Sokrates im berühmten schierlingsbecher zu sich nehmen musste. Ihre wirkung war ein von den unteren zu den oberen gliedmaassen langsam voranschreitendes taubheitsgefühl (»betäuben«). In dem vorangegangenen und von Platon in der Apologie geschilderten gerichtsverfahren hatte Sokrates den ohnehin aussichtslosen kampf gar nicht erst aufgenommen sondern den manipulierten richtern lediglich seine verachtung gezeigt. Ihre willkürliche anklage war politisch motiviert und entbehrte jeder grundlage. - Die konstruktion des nebensatzes ist verkürzt und würde vollständig lauten: »bei dem« oder »wie dünn gerät das gedachte / Dem«. Doch herrscht keine einigkeit über das verständnis des satzes der auch M schwierigkeiten bereitet.
Es bleibt hier offen welcher tat der täter am nächsten tag beim aufgang der sonne sich schuldig gemacht haben wird. Vorstellbar wäre der tyrannenmord. Man muss keineswegs »späterer Leser« sein und den zwanzigsten juli hinter sich haben um auf diese idee zu kommen (wie Egyptien glauben machen will): schon Schiller hatte das politische attentat in der Bürgschaft sympathisch gemacht. Egyptien wäre mit diesem vorschlag jedenfalls nicht einverstanden und nennt ihn »eine verharmlosende Entschärfung von Georges archaischer Ethik« (WK 2017, 303). Aber so »scharf« ist Georges ethik nicht dass sie jede sinnlose grausamkeit mit achselzucken quittieren würde. Die respektvollen worte der freunde zeigen eindeutig dass sich hinter dem TÄTER weder ein ladendieb noch ein berufsverbrecher verbergen kann. Anders als im vorigen gedicht spielt hass keine rolle - auch kein anderer affekt. Des täters lezter wunsch ist bescheiden genug um verwirklichung finden zu können: ein leztes mal im alleinsein ausgerechnet den zu beginn und zulezt genannten »frieden« des abends empfinden zu können (auch Algabal in 3203 war ja »friedenfroher denn ein neues lamm«). Diesem lezten wunsch gab George so viel raum weil er bezeichnend für den TÄTER ist. Wie bereits erwähnt »peinigen« den TÄTER zeitweise »unentrinnbare« skrupel. Die »Verharmlosung« vor der Egyptien warnt hat im grunde George selbst schon vorgenommen · mit einiger sorgfalt und eindeutiger absicht. Ihm eine »archaische« ethik zu unterstellen ist zumindest auf grundlage dieses gedichts nicht möglich. Das bild der germanistik von Georges ethik beruht immer wieder auf ihrem defizitären verständnis des ALGABAL. Das bestimmt und verstellt das verständnis anderer texte dann weitgehend.
Dem Bevorstehenden blickt der TÄTER nüchtern ins auge: der kollektiven hysterie der aufgeputschten menge und - schmerzlicher - den schulterzuckenden floskeln der offenbar nicht eingeweihten »freunde« (die sich in ihrer verständnislosen distanz von denen des Sokrates kaum unterscheiden). Überhaupt ist George ganz und gar nicht ein dichter des freundschafts-pathos. Im gegensatz dazu wurde der begriff viel später im Castrum Peregrini zu einem zweifelhaften popanz gemacht nachdem dort freundschaft in den monaten des untergetauchtseins unleugbar einmal existenziellen wert gewonnen hatte.
Das gedicht ist vor allem ein hymnus auf den stolz und das glück das empfindet wer mit so viel recht stolz auf sich sein darf wie es der TÄTER ist. Es bietet insofern ebenfalls eine verwirklichung des vom engel in 6101 verheissenen schönen lebens. Der täter weiss dass sein leben nicht so belanglos verlief wie das der andern · sein denken nicht so armselig wie ihres war die sich das überschreiten der gesteckten grenzen nicht einmal vorstellen und die somit auch gar nicht in eine situation gelangen können wie er . . und Sokrates mit dem er sich hier auf eine stufe stellt. Dass George eine kriminelle absicht als ausweis standhafter unangepasstheit ehrt ist nicht nur angesichts der gerade auch ihn berührenden rechtlichen gegebenheiten im kaiserreich keineswegs erstaunlich. Ein legalistisches oder rechtspositivistisches verständnis von gesetzen konnte es folglich auch im Kreis nicht geben. Bekanntlich hat dieses gedicht die brüder Stauffenberg davor bewahrt skrupeln angesichts der umsturzpläne nachzugeben · vor allem aber hat es sie bestärkt an diesen plänen überhaupt festzuhalten weil sie zulezt ähnlich selbstzweckhaft waren wie die tat des TÄTERs deren begründung sinn und ablauf George kein wort wert sind. Denn am vorabend des zwanzigsten julis konnten die täter-brüder nicht mehr im ernst von einem gelingen des vorhabens überzeugt sein - genau wie der TÄTER: er weiss dass die »verfolger« ihm schon am tage der tat nah wie schatten sein und die freunde von ihm als einem verhafteten reden werden.
Als der junge Kurt Hildebrandt dem Dichter zum ersten mal vorlesen sollte wählte er DER TÄTER aus. George verlangte ein leidenschaftlicheres lesen und las es "mit dem Ton gebändigter Leidenschaft" erst selbst einmal vor (1960, 181).
6211 SCHMERZBRÜDER
Die zeit der schmerzbrüder ist ähnlich wie die der gleichermaassen zitternden kirchgänger in 6207 und die der alternden lämmer in 6206 so gut wie abgelaufen. Das hätte gar nicht ausdrücklich gesagt werden müssen - es ist doch schon daran erkennbar dass innerhalb dieser gruppe gar keine debatte mehr stattfindet: sie ist nur noch ein »stummer verein« in dem längst »alles gesagt« ist und wo die einzige (und sicher noch jugendliche) »blühende stirn« hinausgedrängt wurde. Diese ist augenscheinlich identisch mit dem »lächelnden strahl« der nun wie ein stern den nächtlichen weg der todgeweihten beleuchtet und sie ihrem ende damit auch schneller näherbringt. Sie klammern sich noch an lezte illusionen (vergleichbar sind sie den priestern im BRAND DES TEMPELS 924 die ebenfalls keine resonanz mehr »empfangen« so dass sie ihre lezte kraft nutzlos »verschenken«) und würden - den untergang bereits vor augen - am liebsten die zeit anhalten . . während ihr begleiter bereits »vom morgen träumt« ohne dass sie es überhaupt noch bemerken. Mangelndes selbstbewusstsein ist hier nicht festzustellen während die alten wie üblich bei George nichts mehr zu lachen haben. Wie alle ihresgleichen leiden sie immer unter irgendwelchem »schmerz« · so sind sie auch benannt und sehen ihrer unabwendbaren lezten »pein« schon »gefasst« entgegen: ein freundliches wort für ergebene tatenlosigkeit. Die matten SCHMERZBRÜDER verkörpern insofern ein dem TÄTER entgegengeseztes extrem. Hildebrandt sieht in dem gedicht einen melancholischen abschied von den "österreichischen Freunden" (1960, 189).
6212 DER JÜNGER
Während in 6211 über den jungen mann der den alten schmerzbrüdern heimleuchtet gesprochen wird ist er es nun selbst der das wort ergreift. Und er spricht wirklich wie ein junger mann: unprätenziös und mehr kraft- als kunstvoll. Der in jeder strofe wiederholte identische reim auf »Herrn« - eigentlich eine hässlichkeit - wird gern in kauf genommen denn wie bei einem Verliebten - einem freilich »hehren« Verliebten - dreht sich für ihn alles nur um den einen menschen. Tatkraft steht dem sprecher hoch über dem poetischen wohlklang. In den beiden ersten strofen werden noch andere angesprochen: zweimal in der ersten · dann noch ein leztes mal. Danach ist der blick nur mehr auf den Herrn gerichtet. Der Herr aber ist nicht der grund dieser abwendung sondern sein eigenes besonderssein: schon immer unterschied sich der jünger indem er »die hehre« liebe begehrte von den anderen denen »die süsse« genügte. Und das ist der lohn: geltung oder anerkennung die der Herr »milde« also freigiebig schenkt (George knüpft hier mit provozierend antimoderner wortwahl an die mittelalterliche spruchdichtung an in der die milte nicht ganz uneigennützig zur zentralen herrentugend gemacht wurde) · des herrn blicke die als die äussere form seiner hehren liebe ebenso wie der anerkennung aufzufassen sind zumal von worten gar keine rede ist · und das glück für die eigene jugendliche bereitschaft zu vertrauen einen inhalt gefunden zu haben. Das gedicht konkretisiert damit das schöne leben · ist zweifellos ein wesentlicher impulsgeber für Wolters’ buch über »Herrschaft und Dienst« und unausgesprochen eine vorgabe für die zugehörigkeit zum inneren Kreis der später entstand. Stauffenbergs attentat dürfte wesentlich als dienst am »werke seines Herrn« zu verstehen sein.
Einen gegenbegriff stellt die »gilde« dar: in einer kaufmännischen vereinigung zählt allein der gesichtspunkts des »lohnes« im engeren sinn. Materielle kalküle sind dem jünger aber fremd. Zu den kalkülen gehört auch die überlegung ob der Herr das vertrauen des jüngers enttäuschen oder gar missbrauchen könnte. Für einen jünger verbietet sich diese überlegung - was zur stärke des Herrn wesentlich beiträgt. Herren deren diener nur dienen solange der sold fliesst oder solange sie nicht zu zweifeln beginnen sind immer nur amtsträger auf zeit und werden auch nicht Herren genannt.
Georges konzeption darf aber nicht mit einem politischen modell verwechselt werden (wozu Wolters allerdings neigte). Zudem beruht die jüngerschaft auf völliger freiwilligkeit - nicht auf verführung und gewalt. Und schliesslich ist der jünger ja eben niemals ein mittelmässiger dummkopf um den man sich sorgen machen müsste.
6213 DER ERKORENE
Der erkorene ist ein vom Herrn erwählter der dadurch eine zweite und »schönere« geburt erfährt und nun von den anderen jüngern beglückwünscht wird. Was andere sich nur schwer aneignen können hat ihm das schicksal schon von anfang an geschenkt so dass ihn die »meister« in gedichten priesen. Als seine wesentlichste tugend - die alle anderen »triebe« (also von geburt an vorhandene anlagen) des menschen überragt - nennen die beiden mittleren strofen die »ehrfurcht« oder »scheu« mit der er solche auszeichnungen entgegennahm wie er sie überhaupt »jeglichem ding« entgegenbringt (es handelt sich also keineswegs um eine form der ehrerbietung gegenüber dem Herrn). Diese veranlagung wird in der geste der geneigten stirn zur anschauung gebracht. Das selbstbewusstsein (V. 6) · die lebensfreude (V. 8) · und kritische grundhaltung (V. 9) dieses jüngers stehen dazu nicht im widerspruch. Wer in blinder begeisterung es nicht erwarten kann den akt der unterwerfung zu vollziehen um fortan in mönchischer entbehrung ein freudloses dasein zu fristen entspricht also keineswegs Georges vorstellung von einem jünger. Der ist vielmehr - M verweist selbst darauf - dem konzept des schönen lebens (6101) zugeordnet.
Die lezte strofe unterstreicht noch einmal die zentrale rolle der ehrfurcht indem sie ihren möglichen verlust ein untreuwerden sich selbst gegenüber nennt. Egyptien hat es auf den punkt gebracht: es komme darauf an »sich durch die Kür nicht zu einer Hybris verleiten zu lassen, die genau dasjenige korrumpiert, das für die Kür prädestinierte« (Wk 2017, 289).
Angesichts des im sommer 1899 abgeschlossenen manuskripts glaubt M nicht dass Friedrich Gundolf das vorbild des Erkorenen war: George hatte Gundolf erst im april erstmals getroffen nachdem dieser das abitur abgelegt hatte. Es handle sich bei dem gedicht - erst recht im hinblick auf eine damals noch gar nicht vorhandene zahl anderer jünger - vielmehr um eine gedankliche vorwegnahme von ereignissen die sich erst später zutrugen.
6214 DER VERWORFENE
Dagegen hält M es für wahrscheinlich dass der Verworfene auf ein bereits länger zurückliegendes geschehen zurückgeht: die begegnung mit Hofmannsthal. M zitiert dazu aus einem brief des neunzehnjährigen aus dem jahr 1893 um mit einigem erfolg nachzuweisen wie George hier züge Hofmannsthals in sein gedicht »hineinverwob«: »man ist wie ein Gespenst bei hellem Tage, fremde Gedanken denken in einem, alte künstliche Stimmungen leben in einem, man sieht die Dinge wie in einem Schleier, wie fremd und ausgeschlossen geht man im Leben herum, nichts packt, nichts erfüllt einen ganz«. In der tat wendet George sich im gedicht gegen vorweggenommene entwicklungsstufen wie man sie bei den sogenannten »Frühvollendeten« findet · gegen eine überfeinerte sensibilität für die eigenen empfindungen und eine übertriebene anteilnahme an anderen. Er kritisiert das gesucht Seltene in deren werken und hält den beifall des ohnehin nur »wirren blinden volks« für schädlich wenn er den jungen liebling des publikums lediglich »berauscht«. Ein rausch der übrigens nicht lange anhält: schon wenig später kann sich der angesprochene so erstaunlich nüchtern einschätzen dass er scham empfindet - was eigentlich doch für ihn spricht. Wie im vorigen gedicht finden die anderen jünger erwähnung - hier werden sie in abgrenzung zu dem Verworfenen die »Reinen« genannt. Die härte gegen den seinen ansprüchen nicht mehr genügenden ist von einer für George typischen konsequenz. Das motiv des kranzes als zeichen der zugehörigkeit zu einer festlich gestimmten gruppe verbindet nicht nur dieses gedicht mit dem vorgänger sondern erschien auch schon viel früher in ABEND DES FESTES 4113.
George selbst war im vergleich zu Hofmannsthal geradezu ein spätentwickler: in einem alter als der Wiener schon meisterwerke veröffentlichte hatte er sich gerade erst mit seinen FIBEL-gedichten abgemüht.
6215 ROM-FAHRER
buhle : einer der darum buhlt (sich darum bemüht) geliebt zu werden. Hier ist Italien gemeint das um die liebe der Deutschen buhlt.
dürftig : hier im sinne von »nicht genug«.
Als Ernst Kantorowicz 1927 die biografie des stauferkaisers Friedrich II. veröffentlichte - im Georg Bondi Verlag mit dem signet von Georges BfdK - wurden pilgerfahrten nach Italien und Sizilien (in Salerno ist Friedrich begraben) unter den jüngeren mitgliedern des Kreises zu einem muss. Mehr als ein vierteljahrhundert früher kam George zu einem zwiespältigen urteil über die begeisterung für Italien das den Deutschen nie »fremdes land geworden« sei. Er denkt an die deutschen herrscher des mittelalters die aus dem albtraum fliehend den der neblige norden ihnen bedeutete über die Alpen gingen - nennt aber gerade die beiden deren italienzüge in katastrofen endeten: den hochbegabten und deshalb schon zu lebzeiten »weltwunder« genannten kaiser Otto III. der auf der flucht vor den römern mit zweiundzwanzig jahren starb und den sechzehnjährigen enkel Friedrichs II. und minnesänger der die schlacht um sein sizilianisches erbe verlor: Konradin wurde gefangen genommen und in Neapel hingerichtet. Das ist das »verderben« das Italien über die deutschen fürsten brachte . . denen ihre »heimat« nicht mehr viel bedeutete und die ihren »kalten« pflichten untreu wurden die sie aufgrund ihres throns eigentlich gehabt hätten · die ihnen aber nur »dürftig« also nicht faszinierend genug erschienen. Und doch wird verständnis gezeigt für Italiens »fesseln«: den duft der frühlingshaften vegetation und den reiz der bauten standbilder und kunstwerke.
Angesprochen werden aber nur die zeitgenossen. Ihnen wird gezeigt dass der bisher so europäisch gesinnte Dichter sich einem nationaleren denken annähert. Es scheint als sollte ihnen ihr »sehnen« genügen: schon damit allein könnten sie ja in der vorstellung an jener flucht der »ahnen« teilhaben. Der ausdruck »silberne galeeren« zielt auf diese macht der fantasie die sich so einen italienzug glänzend ausmalt und die beschwerlichen fussmärsche in eine romantische schiffsreise · die leidvollen qualen in poetische pracht verwandelt. Im grunde ist es doch eine ganz besondere liebe auf die die zeitgenossen gestossen werden: die der beiden jugendlichen helden zu ihrem siegreichen »schönen buhlen« der sie trunken macht · fesselt und ihnen ein tragisches schicksal bereitet. Wenn es in Georges werk jemals ein anzeichen dessen gab was Osterkamp als »Sexualangst« bezeichnet dann lässt es sich anhand des »schönen buhlen« am ehesten diskutieren. Aber jegliche »angst« wird doch »ewig« ganz machtlos sein gegen die faszination: das ist die botschaft.
Das bedeutet freilich nicht dass im gedicht partei ergriffen würde für jene zeitgenossen die in ihrem sehnen aufgehen. Dass sie sich in ihrer vorstellung ausgerechnet in galeeren sehen bringt sie unbewusst in die nähe von sträflingen oder rudersklaven: unfreien und unglücklichen also. Dass sie ihre boote »zitternd« vertäuen erinnert an die schmerzbrüder · und dass sie es vor vermeintlichen »königshallen« tun mag als hinweis taugen dass sie das antike Italien überhaupt verfehlen · sei es räumlich oder geistig. Denn weder im alten Venedig noch in Ostia haben jemals könige paläste erbaut. Es ist beissender spott den die rom-fahrer zu ertragen haben.
6216 DAS KLOSTER
Der maler Guido di Pietro wurde als mönch bruder Johannes aus Fiesole (bei Florenz) genannt: Fra Giovanni di Fiesole. Seine sakralen bildwerke brachten ihm aber auch die bezeichnung Angelico ein. Noch als junger mann war er in Fiesole dominikaner und am ende seines lebens sogar prior dieses klosters geworden. 1452 starb er in Rom. George hatte sich schon in EIN ANGELICO 117 auf ihn bezogen: einen künstler der eine lebensform abseits des üblichen wählte.
Hier aber geht es nicht um den konvent von Fiesole sondern um einen bund der erst noch entstehen soll. Fra Angelico bekommt dabei sozusagen die rolle eines patrons: auch er hatte den mönchischen verzicht mit einem auf schönheit gerichteten blick zu vereinen gesucht. Aber der eigentliche gründer dieses »friedensstifts« ist der sprecher (den M nicht mit George gleichsezt) der sich in der zweiten strofe selbstbewusst ins spiel bringt: er organisierte die »reine schar« der laienbrüder (so M. - Laienbrüder in herkömmlichen klöstern haben nicht wie die eigentlichen ordensbrüder eine theologische ausbildung erfahren). Das präteritum »dang« stammt vom infinitiv »dingen« der im engeren sinne »anwerben« (meist von söldnern) meint.
In den zentralen strofen ist er es der zwei regeln gibt: die pflicht zu tätiger und ernst genommenen (daher »heiliger«) arbeit (und das meint tatsächlich arbeit wie die auf dem feld - wenn auch unter mithilfe der eher jüngeren laienbrüder die sicher alle mühen etwas erträglicher machen) im gleichförmigen tages-ablauf (wobei der tag in sieben abschnitte geteilt ist wie im kloster durch die festen gebetsstunden) und das verbot sexueller beziehungen obwol freundschaftliche paarbildung (hier ist M ganz genau und versteht unter den »frommen paaren« solche aus ordensbrüdern oder laienbrüdern oder gemischte) und körperliche nähe (der kuss ist als ritueller friedenskuss eine auf Paulus zurückgehende kirchliche tradition) zugelassen sind. Spätestens wenn abends das frühere »schluchzen« vor »wort und kuss« flieht klingt etwas von dem im VORSPIEL verheissenen schönen leben an und die frage wäre gar nicht abwegig ob hier nicht der engel als sprecher vorstellbar sei. Das gäbe dem auftrag zur gründung der bruderschaft eine zusätzliche autorität. Die gründungs-legenden vieler klöster sprechen ja von der weisung einer göttlichen stimme.
Wie bei einem kloster üblich grenzt sich auch dieses gegen die in den anfangsversen scharf abgelehnte aussenwelt ab. Diese ablehnung findet sich seit 6205 in fast allen der lezten gedichte und deutet schon voraus auf die ZEITGEDICHTE 71. In diesem zusammenhang steht wol auch die rede vom »ebnen leid« und von »ebner lust«. M versteht darunter eine art auflösung der »Höhen und Tiefen der Empfindungen« (offenbar so wie bei den stoikern die apatheia eine voraussetzung der seelenruhe bildet) · erklärt aber »verzehrt« nicht. Vielleicht ist eher die niedrigkeit von erfreutem und unangenehmem fühlen um eigentlich geringfügiges gemeint in dem sich die künftigen brüder vor ihrem eintritt in die gemeinschaft so verzehrten dass in ihnen nun nichts mehr vorhanden ist was zu ihrem vorigen leben unter den »lauten horden« gehörte. Diese selbstvernichtung (im eher mystischen sinn) ist überhaupt die voraussetzung um den blick zur »blauen schönheit« richten zu können (konkret mag darunter ein von allem begehren freier blick auf ein madonnenbild vor blauem hintergrund · im weiteren sinn jegliche transzendenz zu verstehen sein). Der zeitpunkt des übertritts darf aber nicht so spät erfolgen dass auch die ganze »kraft« unter dem »kalten gift« der profanen welt erloschen ist.
Das gedicht steht in engster verbindung mit dem anschliessenden:
6217 WAHRZEICHEN
Hier wird in fortsetzung des in 6215 eingeführten auf die nation gerichteten denkens zu den deutschen gesprochen. Die eigene zeit wird im anschluss an das vorige gedicht erneut gebrandmarkt. Eine kurze spanne der »stolzen blüte« ist vorbei und das land wird vom »rohen schwärmen« umnachteter kräfte beherrscht - das meint die lange zeit von den bilderstürmern und fanatischen schwärmern der reformationsepoche bis zu den imperialistischen grossmachtträumen des bürgertums und der kaiserlichen regierungen. Neue orientierung sollen »frühe« bildende künstler aus deutscher vergangenheit (und der vom anschliessenden gedicht angesprochene dichter Jean Paul) bieten. Der text nennt nur Hans Holbein (den jüngeren) · M weiss aber dass George auch an Meister Wilhelm (von Köln) und Stefan Lochner (vergleiche 7734) gedacht hat da von malern aus dem Rhein- und Maingebiet die rede ist. Sie werden als eine art nationale schutzheilige · ihre werke als heiligtümer gesehen (dass ihre madonnen als »schar« bezeichnet werden ist eine blasfemisch-provozierende aufwertung der im vorigen gedicht genannten »reinen schar«) denen der allgemeine niedergang (im bild des unter dem unfruchtbarkeit und dürre bringenden wurms leidenden landes) nichts anhaben kann. Von ihrem »glanz« - man soll an die goldstrahlenden altarbilder Wilhelms und Lochners denken - geht immer noch eine segen stiftende kraft aus und ihre schöpfer werden als »geister« machtvoll - es ist der beginn der gestalt-idee - nach Deutschland zurückkehren · das »land des traums und der legende«.
Dort wurde die kyffhäuserlegende über die jahrhunderte tatsächlich immer wieder neu aufgewärmt wenn trost und hoffnung gefragt waren. Dass sie sich doch gerade nicht erfüllte spielt keine rolle. Es geht allein um die stärkung die aus der kunst - dem anschaulich gewordenen »traum« - erwachsen kann wenn nur wie in Deutschland die bereitschaft zu glauben noch lebt.
Wie das funktioniert wurde im vorangegangenen gedicht mit dem blick der »brüder« zur »blauen schönheit« ja gerade erst erklärt um deren kraft sich WAHRZEICHEN dreht. Und es ist kein zufall dass dort auch regeln für eine neue klösterliche gemeinschaft genannt werden die sich unübersehbar an den »alten« · mit recht auch »leidensregeln« genannten zisterzienser-gesetzen orientieren. Das kloster-gedicht kann somit als demonstration jener orientierung an der vor-reformatorischen zeit verstanden werden die in WAHRZEICHEN propagiert wird und deren wahrzeichen die madonnen-glorienschar darstelltt.
6218 JEAN PAUL
war neben Hölderlin die prominenteste wiederentdeckung im George-Kreis. Max Kommerell schrieb gleich zwei bücher über ihn und gerade in der jüngsten generation die Kommerells 1928 bei Bondi erschienenes hauptwerk »Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik« - da war der autor selbst gerade erst sechsundzwanzig jahre alt - gelesen hatte galt die genaue kenntnis seiner romane als voraussetzung um mitreden zu können.
kolk : hier ist der Bodensee gemeint.
pfühl: kissen
Aber schon hier wird belesenheit vorausgesezt - längst nicht erst in den ortsangaben aus dem schlussvers. Jean Paul wird in der direkten anrede dafür gelobt dass er »uns« zurückruft wenn
ein »schönerer nachbar« wie etwa Italien (Egyptien liest im Wk 2017, 292 falsch von der suche nach »schöneren nachbarn«) bei uns - den »Stets-wandrern« (die also gern ständig auf reisen sind) - die liebe zur heimat würgt und sie dadurch schmälert. Für den rest hilft M: »verlockend quälend« bezieht er auf Jean Pauls (nicht gerade leicht zu lesende) werke in deren autor er dennoch »den Gott« lebendig wähnt. Der begriff ist im George-Kreis nicht immer eindeutig: manchmal ist Eros gemeint · manchmal einfach ein erhebendes Göttliches oder eben beides. Viel wichtiger ist das vorhandenseins des »drangs«.
Jean Paul ist mehr als jeder andere weise in Deutschland · dem land der »grauen gaue«. Auch er kennt die sehnsucht nach dem süden und presit sogar dessen heiterkeit (M erinnert an die beschreibung der Isola Bella im »Titan« - »ohne sie jemals gesehn zu haben«). Wie im ganzen »etwas schlaffen« und im trüben vor sich hindämmernden volk der deutschen schlummert auch in ihm etwas woraus unerwartet »gluten« entstehen können. Überall (in wald und feld) ist er »herr und kind«: anerkannt und geliebt. Die lezte strofe ehrt schliesslich die zugleich anregende und beruhigende Wirkung seiner musikalischen dichtung.
6219 STANDBILDER: DIE BEIDEN ERSTEN
Die STANDBILDER sind Georges bergpredigt: es geht um tragende pfeiler seiner weltanschauung und deshalb ist der begriff von »standbildern« besonders treffend. Der Dichter hat dem ihm wichtigsten die gestalt von frauen( ! )-statuen gegeben - die also für verehrungswürdige geistige kräfte stehen.
Hier sind zunächst der griechische tempelbau und anschliessend die gotische kathedrale gemeint. Die kennzeichen der jugendlichen besucher des ersteren sind die stolze haltung und die freude am eigenen körper »und seiner lust« während die himmelstrebenden spitzen türme und die zarten rosetten der gotik die flucht vor erde und körperlichkeit anzeigen. Das spiegelt sich im nach oben gerichteten auge und der form des fingers dem sogar die enthaltsamkeit anzusehen ist zu der sich die christliche gotik bekennt. Dem christentum werden erhebende größe und macht zugestanden: das »ganze volk« vermag in »frommen rausch« - in religiöse ekstase zu geraten (das ist in T062 und am ende von 7108 noch deutlicher positiv gewertet weil das volk in dieser situation - und nur in dieser allein - »schön« werden kann). Aber während die jungen griechen lächeln zittern die christen. Das ist nicht unbedingt angst · aber das empfinden der eigenen kleinheit und das gegenteil des stolzes · der heiteren festlichkeit der griechen. Das gedicht kann als illustration zu dem im VORSPIEL gegebenen zentralen motto aufgefasst werden: »Hellas ewig unsre liebe« (6107).
6220 STANDBILDER: DAS DRITTE
Das dritte standbild erscheint als verhüllte frau weil es für den traum steht: ob seine verwirklichung dereinst gelingen wird ist jedem ein geheimnis. Sie vermag sogar die hoffnung zu wecken dass jenseits des horizonts noch immer ein paradies - das eden - gefunden werden könne. Ihre aufmunternde kraft ist gerade für »die untern« (vielleicht gar die einfach nur verliebten »irren« (vergleiche 6222,2) oder jedenfalls die in ihrer überzeugung oder ihrem vorhaben unsicher gewordenen · sogar die »kranken« und vielleicht alle schwachen von den George ja sonst nicht oft spricht) unerlässlich. Aber die kraft des traums · seine ganze existenz ist äusserst gefährdet. Dem allzu wissensdurstigen sprecher - bislang ein bewunderer den es nun aber nach einer art kritischen analyse verlangt - antwortet die verhüllte in den beiden lezten strofen auf so desillusionierende weise dass sie beinahe zynisch erscheint. Den nach aufklärung lechzenden weist sie als »kind« zurück (weil er durchschauen möchte was besser geheimnis bliebe). Indem sie ihm rede und antwort steht hebt sie sich selbst auf zugunsten eines trostlosen materialismus und öder psychologie. Der eigentliche antrieb der hoffenden sei immer nur deren not (und damit vermindert sie ihre eigene bedeutung). Sie selbst hingegen habe lediglich dafür gesorgt dass jeder erfüllten hoffnung neue bange ungewissheit gefolgt sei - sie habe alte durch neue qualen ersezt. Das standbild weiss dass es dem sprecher durch diese aufklärung nicht geholfen hat (denn er wird nie mehr an den traum glauben können und fällt damit auch als künstler im grunde aus). Die selbstaufhebung wird symbolisiert in der aufforderung er möge ihr den nun sinnlos gewordenen schleier lüften. Er werde dann erkennen dass die diamantenen strahlen die ihm bislang durch das gewebe zu schimmern schienen in wahrheit etwas ganz anderes waren (nur ihre tränen - M beruft sich hier auf eine äusserung von George selbst. Die tränen haben damit zu tun dass ihr der täuschende charakter ihrer tätigkeit selbst bewusst war). Das gedicht ist fundamental für Georges auffassung von aufklärung und geheimnis - und damit für seinen antimodernismus (der aber selbst ein aufgeklärter ist).
Es liegt in seiner konsequenz dass George sich als künstler selbst aufhebt wenn er den traum als idealistisches trugbild demaskiert. Es scheint dass er diese konsequenz nun ihrerseits aufzuheben versucht indem er die fortsetzung des dichtertums zu einer frage von disziplin oder pflichtbewusstsein · beinahe von selbstaufopferung macht (zu der naturgemäss die meisten nicht bereit wären). Denn es geht darum die eigene aufgeklärtheit zu ignorieren.
6221 STANDBILDER: DAS VIERTE
Folgerichtig ist der pflicht das nächste standbild gewidmet. Im tempel alles wirklich Wichtigen ist »nun auch« ihr ein pfeiler geweiht und ihr »zwang« wird nicht mehr in frage gestellt wenn er immerhin edel genannt wird. Doch mag es verdächtig erscheinen dass nur die erste strofe anerkennend von ihr spricht - alle anderen aber in wehmütiger erinnerung an die zeit schwelgen als man sich ihrem »starren kalten« blick entzog und fluchtartig mit sack und pack und allem was einem lieb war den strand verliess . . um mit dem überladenen schiff flugs »zum nächsten frohen eiland« zu »enteilen«. Damals schallte die luft von »sang und klang« - heute hört man das gebetsgemurmel gebeugter gestalten.
M erkennt in den angesprochenen »Gespielen« (welcher begriff den sprecher einschliesst und die früher eher verspielte denn pflichtstrenge grundhaltung andeutet) die drei bewidmeten freunde der BÜCHER 4 - also Waclav Lieder der als pole von »fremdem stamme« war · Paul Gérardy mit dem George jene abendspaziergänge unternahm derer schon in 4206 gedacht ward und natürlich Karl Wolfskehl dessen körperliche erscheinung an eine »östliche Prophetengestalt« denken liess. »Kuss« und »Flamme« werden grossgeschrieben als zeichen der ehrerbietung für diese personen. Das ist bemerkenswert weil sie doch als vertreter des verspielten lebens (oder der ästhetizisschen kunst) scheinbar abgewertet wurden. Vielleicht ist Egyptiens gutgläubigkeit gegenüber dem »selbstkritischen Rückblick« allzu einseitig. Kein wunder dass er etwas ratlos den »deutlichen Kontrast zum dritten Vorspiel-Gedicht« mit dem aufruf des engels »Zu schönerm strand die segel aufgehisst !« konstatiert (Wk 2017, 294). Das muss kein zeichen für unentschiedenheit sein. Aber schon der ganz junge George war sich immer des verlust bewusst der mit dem wandel einhergeht - sein umgang mit kirche und katholizismus ist der beste beleg dafür (vergleiche SEEFAHRT 0306). Und wenn die pflicht nun aufnahme im tempel gefunden hat bedeutet das nicht zwangsläufig dass andere götter ihren platz räumen müssen. »Hellas ewig unsre liebe« gilt bei George immer. Zugleich bezeugt M aus eigener anschauung wie schwer es auch dem nicht mehr ganz jungen George bisweilen fiel unter termindruck die dichterische arbeit zu ende zu bringen - freilich weniger schwer als den freunden die damals als beiträger der BfdK nicht immer ganz zuverlässig waren.
6222 STANDBILDER: DAS FÜNFTE
lässt eine die liebe verkörpernde frau zu wort kommen die zunächst scheinbar so wenig zweifel an ihrer macht zulässt dass Egyptien sich sogar verleiten lässt ihr prahlerei vorzuwerfen. Aber solches verhalten passt doch gar nicht zur würde der unantastbaren standbilder. Und nichts von dem was sie über das vermögen der liebe feststellt ist zum ersten mal gesagt · schon gar nicht die vorstellung dass der gott (Eros) sich ihrer bedient um den einzelnen in einen wahnzustand zu versetzen. So vermag sie ihm sogar alles schwach oder langweilig erscheinen zu lassen an das er bislang »fest« glaubte. Alles schon oft gehörte (und es hat immer eine absicht wenn George · selten genug · etwas längst gesagtes wiederholt) dient lediglich als folie vor der sich das anschliessende neue um so eindrücklicher abhebt. Und das ist der gedanken dass die liebe grausame gesetze erfindet: beispielsweise dass keiner dem der (sexuelle) genuss ihres »schoosses« gewährt wurde sich auch an ihrer liebe - anschaulich gemacht im ihrer »lippe süsse« genannten kuss - werde »letzen« also erfreuen oder laben können. Nach dieser auffassung schliessen gegenseitige liebe und ein im engeren sinn sexuelles geschehen (das demnach nur dort stattfindet wo es nicht dem fühlen sondern einem einseitigen nehmenwollen oder der aussicht auf eine vereinbarte gegenleistung entspringt) einander eigentlich aus (ähnlich aber mit anderer begründung in Schopenhauers Metaphysik der Geschlechtsliebe wo es sich jedoch nicht um gleichgeschlechtliche liebe handelt. Die aber ist hier gemeint · anders wäre der begriff des gesetzes nicht treffend). Einen bezahlten lustknaben lässt George in 7106 sich selbst rechtfertigen. Erinnert sei noch einmal daran dass dieses »gesetz« - und ein solches ist im wörtlichen sinne gemeint - zu den grausamsten gezählt wird.
Natürlich sind die worte dieses standbilds eine einzige provokation · gesprochen allein um den widerspruch zu wecken denn es ist ja gar nicht die liebe die solches gesetz »erfindet« · die für »abgrund« und »todes fluch« verantwortlich ist. Freilich vermag sie bisher enge horizonte zu weiten (zu »ändern« heisst es sogar und das ist eigentlich der springende punkt). Dass die geweiteten horizonte durch blutige märtyrerstrahlen begrenzt werden liegt nicht an ihr.
Der widerspruch aber lässt auf sich warten: »Ihr fraget nicht . . ihr glaubt und duldet bloss.« Denn noch sehen die duldenden alle schuld bei sich.
todes fluch : hyperbel für eine sehr ernst zu nehmende strafandrohung
schalmei: ein holzblasinstrument das in mittelalter und renaissance verbreitet war als es noch keine oboen gab. Sie war auch das instrument der in zahlreichen werken der bildenden kunst dargestellten römischen pifferari. Der begriff war aber ohnehin jedem aus dem Alten Testament bekannt. Hier allerdings endet wer dem wohlklang nachgeht im gefängnis - da wird der horizont dann wieder enger.
6223 STANDBILDER: DAS SECHSTE
Auch in den beiden lezten gedichten dieser reihe spricht das standbild selbst. Das vorlezte verkörpert die faszination die von menschen ausgehen und die leidenschaft die von ihnen geweckt werden kann. Es sind aber menschen die im kunstwerk dargestellt werden: die jungen wettkämpfer auf den antiken rotschaligen urnenförmigen vasen gerade noch zu erkennen sind · von den bildhauern der renaissance als glänzende marmorne engel dargestellte idealkörper die dazu verführen geküsst zu werden · in erlesensten farben porträtierte herrscher die allein schon durch ihre namen »angst und verlangen« hervorrufen (warum Egyptien in Wk 2017, 296 diese portraits apodiktisch dem »bürgerlichen zeitalter« zuordnet bleibt unerfindlich). Diese kunstwerke übertragen die leidenschaft die - ausgehend von haaren und blicken - schon in ihren »bildnern« entfacht wurde auf die betrachterin. Erst recht ein mund veranlasst sie zu der vorstellung wie er wol küsste - und er vermag ihre eigene »begier« zu entfachen obwol er doch nur ein im kunstwerk dargestellter mund ist: ein wunder so als ob tatsächlich rauch entstünde wo doch gar keine echte flamme ist. »Hier springt kein Funke über« urteilt Egyptien (ebd.) der meint die portraits würden als »defizitär« eingeschäzt (ebda.) - aber das gegenteil ist zutreffend.
EIn wahres kunstwerk verfügt über erotische kraft die im besten fall der eines menschen nicht nachsteht (und dieses prinzip ist für das verständnis jedenfalls der Georgeschen lyrik fundamental).
6224 DER SCHLEIER: DAS SIEBENTE
Vom einfluss der kunst - und sicher sind damit auch gedichte gemeint - auf die vorstellungskraft spricht endlich das siebente standbild. Die frau vermag den schleier ganz beliebig zu werfen: auch so dass bei allen lesern oder betrachtern die bislang nur herkömmliches gewohnt sind »das Bild eines ihnen bisher völlig fremden Lebens« (M) entsteht - hier veranschaulicht durch die silhouette einer faszinierenden stadt des orients. Bei einem früheren wurf des schleiers gelang auch dies schon: was blosse zäune im regen vor den häusern waren - »schranken« steht hier um an die beschränkung des alltags zu erinnern - kann im kunstwerk silberblass wie im mondlicht wirken - sogar »am vollen mittag«. Beim dritten wurf des schleiers werden hirten sichtbar wie sie in der jungsteinzeit damit beginnen die auen der flusstäler als weidegrund zu nutzen. Die geschmeidigen bewegungen der mädchen hingegen erinnern an jene jungfrauen die sich in religiöser ergriffenheit in den dienst einer Göttin stellten.
Kränze aus der Afrodite geweihten myrtenzweigen waren schon in der antike brautschmuck. Wenn sich das paar unter einem myrtenstrauch befindet sind beide wol fest füreinander bestimmt.
Bei der dritten strofe wird man damit an eine bukolische idylle denken wie sie aus der bildenden kunst des achtzehnten jahrhunderts und den gedichten der anakreontik bekannt sind. All diese historischen färbungen erinnern deutlich an George-gedichte wie man sie nicht nur aus den drei BÜCHERN 4 kennt. Allerdings besteht Egyptien wegen des präteritums - und wol auch des mondlichts - darauf dass sich die zweite strofe auf die dichtkunst der romantik beziehe (Wk 2017, 296).
Das lezte beispiel für einen wurf des schleiers und damit die lezte strofe dieses zweiten buchs knüpft an die verheissung des schönen lebens im VORSPIEL an: dieses lebensgefühl vermag durch kunst bei vielen geweckt zu werden. Dass sie dem sehnen die richtung vorgeben kann wird mit so viel stolz festgestellt dass die »kritische« germanistik hier selten die gelegenheit verpasst die klage über Georges allmachtswünsche anzustimmen. Zutreffend ist natürlich dass in allen vier strofen und erst recht in der lezten die eigenen gedichte gemeint sind. Und dass sie die gegebenen versprechen einzulösen vermögen. Das dritte standbild hatte womöglich noch selbstzweifel angedeutet in der frage mit welcher legitimität und nachhaltigen wirksamkeit kunst eingesezt werden darf um der betrübnis und müdigkeit des profanen lebens abzuhelfen. Das siebente standbild steht gar nicht mehr unter rechtfertigungsdruck wo es nun um das eigentliche betätigungsfeld von kunst geht: die verzauberung.
dein gewohntes tor : M denkt an das (1850 fertiggestellte) Münchner Siegestor und »dein« wird dann als selbstansprache aufzufassen sein. Ludwig I. hatte es noch in auftrag gegeben zum andenken an die siege über Napoleon an denen die bayrischen truppen ihren anteil hatten. Wer will kann die identifizerung mit diesem baudenkmal auch als weiteren hinweis auf eine zunehmend nationaler werdende gesinnung Georges nehmen auch wenn Napoleon im Kreis zu den grossen gestalten gezählt wurde. Den dafür verantwortlichen Berthold Vallentin - einen juristen der nach seiner promotion zusammen mit Friedrich Wolters bei Kurt Breysig in Berlin geschichte studiert hatte - lernte George erst 1902 kennen · zwei jahre nach veröffentlichung des TEPPICHs.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.